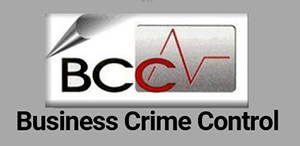Am 12. Oktober 2023 teilte der Bundesgerichtshof mit, dass die Revision des Cum-Ex-Steuerbetrügers Hanno Berger gegen die vom Landgericht Bonn verhängte achtjährige Haftstrafe verworfen worden sei. Das Verfahren ist damit abgeschlossen und der 72-jährige Berger rechtskräftig verurteilt.
Eine zweite positive Nachricht stellt die neue Entwicklung im Machtkampf um Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker (Staatsanwaltschaft Köln) dar. Benjamin Limbach (Bündnis 90/Die Grünen), Justizminister in NRW, hatte kürzlich überraschend angekündigt, Brorhilkers Hauptabteilung in zwei eigenständige Sektionen aufspalten zu lassen – was bedeutet hätte, dass der wichtigsten Cum-Ex-Ermittlerin ein großer Teil ihrer Fälle weggenommen worden wäre, um diese in die Zuständigkeit eines mit dem Thema wenig vertrauten Juristen zu übergeben. In den Medien war von einer geplanten „Entmachtung“ Brorhilkers die Rede. Nach breiter öffentlicher Kritik hat Limbach nun einen – vorläufigen – Rückzieher gemacht. Am 8. Oktober teilte er mit, dass die Hauptabteilung nun doch als Ganzes beibehalten werden soll. Zudem würde sie vier zusätzliche Planstellen erhalten und somit von derzeit 36 auf 40 Staatsanwält:innen anwachsen. Die Auswirkungen der Maßnahmen sollen laut Limbach im Juli 2024 bewertet werden.
Einige Pressestimmen zur aktuellen Situation:
„Die Darstellung Limbachs, Brorhilker entlasten, die Effektivität der Arbeit steigern und Kontinuität bei einem ‚unvorhergesehenen, etwa krankheitsbedingten Ausfall‘ gewährleisten zu wollen, wirkte nicht überzeugend. Dagegen hatte etwa Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung ‚Finanzwende‘, vor einem schweren Rückschlag bei der Aufklärung des größten Steuerdiebstahls in der deutschen Geschichte gewarnt. Damit stehe die bisherige Linie, alle Cum-ex-Verbrecher vor Gericht zu bringen, zur Disposition, hatte Schick beklagt. Dagegen gebe es Akteure im NRW-Justizapparat, die ‚Deals‘ bevorzugten, mit denen sich Kriminelle von einer angemessen Bestrafung freikaufen könnten.
Nachdem Limbach sein Projekt zuletzt noch verteidigt hatte, gibt er sich nun betont konziliant. Er nehme die Einwände, die selbst von der Generalstaatsanwaltschaft kamen, ‚sehr ernst‘, (…), was auch für die Sorge einiger gelte, die Maßnahme könne die Cum-ex-Ermittlungen beeinträchtigen. Ziel aller Überlegungen und Maßnahmen sei es im Gegenteil, das Fahndungsteam ‚zu stärken, um so noch bessere Bedingungen für die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zu schaffen und dadurch umfassende Aufklärung zu ermöglichen‘. Gleichwohl könnte Limbachs Rolle rückwärts auch nur eine auf Zeit sein, bis sich die Wogen geglättet haben. Zunächst wolle er sich mit den Verantwortlichen bei der Generalstaatsanwaltschaft und Staatsanwaltschaft austauschen, bemerkte er. ‚Wenn wir dabei geeignetere Wege finden, bin ich selbstverständlich auch offen dafür, die in Rede stehende Organisationsentscheidung rückgängig zu machen.‘ Und wenn nicht?
Auf alle Fälle erscheint das Verhältnis zwischen Limbach und Brorhilker, die sich den Ruf als unbeugsame Kämpferin gegen die ‚Cum-ex-Bande‘ erworben hat, nachhaltig zerrüttet.“
(junge Welt vom 10. Oktober 2023)
„Berufspolitiker können in aller Öffentlichkeit ihren ‚Canossa‘-Moment durchleben: Nach der Kritik von Rechts- und Finanzpolitikern sowie dem Widerstand aus den Reihen der Strafjustiz hat Benjamin Limbach (…) eine bemerkenswerte Kehrtwende vollzogen. Reumütig erteilte Limbach der geplanten Aufspaltung der Kölner Staatsanwaltschaft, die eine Schlüsselrolle in der Aufklärung des milliardenschweren Steuerskandals ‚Cum-ex‘ spielt, eine Absage. (…) Für einen Sinneswandel hat seinen Worten nach ein Treffen im Ministerium am vergangenen Mittwoch gesorgt, an dem unter anderem auch Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker, bisher in Köln alleinige Hauptabteilungsleiterin für die Cum-ex-Fälle, teilnahm. (…) Auf Nachfrage erklärte der Justizminister, er habe deswegen lange nicht das Gespräch mit Brorhilker gesucht, weil dies Aufgabe des Leitenden Oberstaatsanwalts sei. Dies entspreche seiner Ansicht von ‚Führungsmanagement‘ in der Justizverwaltung. Brorhilker hatte sich intern mit einem Brief an den Hauptstaatsanwaltsrat gewandt, der die oberste Personalvertretung innerhalb des Justizministeriums ist. Darin warf sie Limbach Fehler und irreführende Darstellungen zu den Cum-ex-Ermittlungen vor.“
(FAZ vom 13. Oktober 2023)
„Seit zehn Jahren verfolgt Brorhilker mutmaßliche Steuerdiebe rund um den Globus, bis nach Australien, und hat dabei viel erlebt: einen weinenden Privatbankier; erboste Anwälte, die ihr alles Mögliche vorwerfen; oder widerspenstige Drahtzieher, die sich angesichts drohender Haftstrafen plötzlich in redefreudige Kronzeugen verwandeln. Was die schier ruhe- und rastlose Oberstaatsanwältin in diesen zehn Jahren bislang nicht erlebt hat, das ist ein Minister, der sich ihr gewissermaßen in den Weg stellt. Noch dazu ein Politiker der Grünen, die lange Zeit wie kaum eine andere Partei für Aufklärung gesorgt haben. (…) Jetzt hat Minister Limbach zu spüren bekommen, was es heißt, sich mit Brorhilker anzulegen. (…) Mehr als 60.000 Menschen* haben nach Angaben der Organisation Finanzwende eine von diesem Verein initiierte Eingabe unterschrieben. Darin wird die Landesregierung in NRW aufgefordert, die Cum-ex-Hauptabteilung H bei der Kölner Staatsanwaltschaft nicht aufzuspalten, sondern auzubauen.“
(Süddeutsche Zeitung vom 10. Oktober 2023)
* (Finanzwende selbst spricht in einer Meldung vom 13. Oktober 2023 von mehr als 80.000 Unterschriften)
Grundsätzliche Überlegungen zum Verhältnis von Politik und Justiz stellen Süddeutsche Zeitung und Focus Online an:
„Es ist ein seltsamer Termin, der an diesem Mittwoch im nordrhein-westfälischen Justizministerium in Düsseldorf stattfindet. Die Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker kommt, und zwar auf Wunsch von Minister Benjamin Limbach. Der Grünen-Politiker will mit der Ermittlerin besprechen, wie in einem der größten Steuerskandale in Deutschland weiter verfahren wird. (…) Der ungewöhnliche Termin und seine Vorgeschichte sind ein Lehrstück darüber, was Minister gerade nicht tun sollten. Sie sollten grundsätzlich nicht in Ermittlungsverfahren von Staatsanwaltschaften eingreifen. Und dies erst recht nicht in politisch heiklen Fällen wie Cum-Ex. (…) In einem der vielen Verfahren dazu geht es auch um merkwürdige Vorgänge bei der Hamburger SPD. Und damit um die Rolle des heutigen Kanzlers Olaf Scholz als damaliger Bürgermeister in Hamburg, gegen den aber nicht ermittelt wird. Die Grünen regieren als Juniorpartner mit der SPD in Hamburg und im Bund in Berlin. In beiden Parlamenten ist in Sachen Cum-Ex vom ursprünglichen Anspruch der Bürgerrechtspartei, für Transparenz zu stehen, nicht viel übrig. Aus Rücksicht auf den Partner halten sich die Grünen bei der Aufklärung fragwürdiger Vorgänge um die SPD und den damaligen Bürgermeister Scholz in der Hansestadt auffällig zurück. Brorhilker hingegen will unbedingt wissen, wie es dazu kommen konnte, dass der hanseatische Fiskus die dortige Privatbank Warburg zeitweise sehr geschont hat. (…) Dass Limbach sich in dieser Lage als grüner Minister in die Arbeit der Kölner Staatsanwaltschaft einmischt, zeugt von mangelndem Fingerspitzengefühl und fehlender politischen Weitsicht. (…) Was der grüne Minister da treibt, wirft jedenfalls die Frage auf, warum Deutschland als demokratischer Rechtsstaat überhaupt noch am Weisungsrecht von Justizministerien gegenüber Staatsanwaltschaften festhält. (…) Die Weisungsbefugnis sollte stark eingeschränkt werden. Pläne dafür gibt es seit Jahren. Sie sollten endlich umgesetzt werden.“
(Süddeutsche Zeitung vom 11. Oktober 2023)
„Während die Deutschen gebannt auf die Wahlergebnisse schauten, machte der grüne nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach am Sonntag einen spektakulären Rückzieher: Er verzichtet auf den Umbau der Staatsanwaltschaft in Köln, der Steuerbetrugsermittlungen behindert hätte. Einer, der jetzt wieder zittern muss, ist Kanzler Olaf Scholz. (…) Mit seiner politischen Kehrtwende gibt er seinen Kritiker Recht: Sie hatten darauf hingewiesen, dass die Umstrukturierung der Abteilung Deutschlands hartnäckigste Verfolgerin der kriminellen Cum-Ex-Geschäfte, die Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker, in ihrer Arbeit behindern würde.
Der Skandal dahinter ist riesig: Namhafte Adressen aus der deutschen Finanzwelt waren jahrelang an krummen Geschäften zu Lasten des Steuerzahlers beteiligt. Die Politik schaute zu – oder war sogar behilflich. Mancherorts wird deswegen hartnäckig ermittelt, andernorts sieht man keinen besonderen Grund dafür. In Hamburg, wo möglicherweise mit Wissen des ehemaligen Bürgermeisters und heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz der größte Schaden entstanden ist, gehören die Ermittler eher zu der zurückhaltenden Fraktion. In Köln allerdings sitzen die Unbeugsamen. Und ausgerechnet sie wollte der grüne Justizminister ausbremsen. (…)
Mit im Fokus stehen dabei: Der damalige Finanzsenator Peter Tschentscher, heute Hamburger Regierungschef, und sein Vorgänger als Erster Bürgermeister: Olaf Scholz. Gegen sie gab es seit Bekanntwerden des Skandals mehrere Strafanzeigen: Sie hätten Beihilfe zur Steuerhinterziehung durch das Bankhaus seit 2007 geleistet, und im Falle Scholz auch noch uneidliche Falschaussage geleistet, so formulierte es der Strafrechtler Gerhard Strate in seiner 38-seitigen Strafanzeige zu Jahresbeginn. (…)
Im März 2022 lehnte die Staatsanwaltschaft Hamburg nach nur vier Wochen Prüfung die Eröffnung eines Strafverfahrens ab. Scholz habe glaubhaft gemacht, dass er sich an Gespräche mit dem Warburg-Bankier Christian Olearius 2016 und 2017 nicht erinnern könne. (…)
Staatsanwälte in Deutschland sind weisungsgebunden. Da kommt schnell die Vermutung auf, dass aus der Politik eindeutige Hinweise gegeben wurden, die man nicht ablehnen kann. Jedenfalls in Hamburg. (…)
Ganz anders läuft es in Köln. Hier ermittelt seit Jahren Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker. Zunächst mit einem kleinen Team gegen Verdächtige aus dem Kölner Raum in Zusammenhang mit den Hamburger Vorgängen. Brorhilker ließ sich nicht abwimmeln, und je intensiver in Köln ermittelt wird, umso blamierter steht die Hamburger Justiz da. Und desto gefährlicher wird es für einige prominente Namen. Dann allerdings schien auch die nordrhein-westfälische Politik ihrem Justiz-Star ins Handwerk pfuschen zu wollen.
Justizminister Limbach, heute Grüne, bis 2018 bei der SPD, wollte über den neu ernannten Leiter der Staatsanwaltschaft Köln, Stephan Neuheuser, eine Reorganisation durchsetzen.“
(Focus Online vom 9. Oktober 2023)
Das Handelsblatt verweist darauf, wie viel Aufklärungsarbeit bei Cum-Ex noch zu erledigen ist:
„Arbeit gibt es noch reichlich: Die Staatsanwaltschaft verfolgt aktuell rund 120 Ermittlungskomplexe mit etwa 1700 Beschuldigten. Bis heute hat die Behörde zehn Anklagen gegen 13 Angeklagte geschrieben. Es gibt mehrere Verurteilungen, drei davon hat der Bundesgerichtshof bereits bestätigt.
Der Großteil der Ermittlungen ist noch lange nicht abgeschlossen. Erst in jüngerer Zeit hat die Staatsanwaltschaft zahlreiche an Cum-Ex-Geschäften beteiligte Großbanken durchsucht, zuletzt die französischen Institute Natixis und BNP Paribas und die japanische Großbank Nomura. Anfang 2023 gab es auch eine Razzia bei ehemaligen Topmanagern von HSBC Trinkaus in Düsseldorf.
Das Ausmaß des Skandals ist in Deutschland bisher ohne Beispiel. Die Staatsanwaltschaft stößt deshalb an ihre Kapazitätsgrenzen. Kritiker hatten gemutmaßt, dass die strafrechtliche Aufarbeitung des Skandals vernachlässigt wird. Die Aufteilung der Hauptabteilung unter Leitung eines relativ unerfahrenen Oberstaatsanwalts könne zu schnelleren Einstellungen führen, so die Befürchtung. Doch jetzt bleibt zunächst alles bei der bisherigen Struktur.“
(Handelsblatt vom 12. Oktober 2023)
Auch die Bürgerbewegung Finanzwende betont in einer Mitteilung vom 13. Oktober, dass der Kampf gegen Cum-Ex weiterhin defizitär ist:
„Wirklich unglaublich: Der NRW-Justizminister Limbach plante die Aufspaltung der Abteilung, die bei der Kölner Staatsanwaltschaft für die juristische Aufarbeitung des Cum-Ex-Steuerraubes zuständig ist. (…) Doch dazu ist es nicht gekommen! Finanzwende startete umgehend eine Petition (…) für die politische Rückendeckung Brorhilkers und forderte eine personelle Aufstockung ihrer Abteilung statt der geplanten Umstrukturierung. Über 80.000 Bürger*innen haben sich in kürzester Zeit mit ihrer Unterschrift unserer Forderung angeschlossen, Cum-Ex-Täter*innen nicht davonkommen zu lassen. (…) Trotz dieses Erfolges gibt es aber weiter viel zu tun. Die angekündigten Stellen müssen erst noch besetzt werden. Zudem sollten pro Staatsanwalt und Staatsanwältin mindestens acht Ermittler*innen von anderen Behörden wie Steuerfahndung und Polizei zur Verfügung stehen. Wir sind also noch lange nicht da, wo wir bei der Bekämpfung von CumEx eigentlich sein müssten.“
Zum Schluss sei auf den Hintergrundartikel von Herbert Storn (Business Crime Control) vom 11. Oktober 2023 in Makroskop (Das Magazin für Wirtschaftspolitik) verwiesen:
„Die Cum-Ex-Lobby schlägt zurück“,
https://makroskop.eu/33-2023/die-cum-ex-lobby-schlagt-zuruck/
Die Situation bis zur „Kehrtwende“ des Justizministers von NRW in Sachen Organisationsstruktur der Staatsanwaltschaft Köln beleuchtet detailliert der Podcast „Handelsblatt Crime“ (vom 8. Oktober 2023):
https://www.handelsblatt.com/audio/crime/eklat-in-der-nrw-justiz/29431978.html
Quellen:
„Cum-ex: Justizminister mit Kehrwende“, FAZ vom 13. Oktober 2023
Klaus Ott: „Machtkampf um die Cum-Ex-Aufklärerin“, Süddeutsche Zeitung vom 10. Oktober 2023
ders.: „Einmischen verboten“, Süddeutsche Zeitung vom 11. Oktober 2023
Ralf Wurzbacher: „Limbach macht halbe Rolle rückwärts“, junge Welt vom 10. Oktober 2023
https://www.jungewelt.de/artikel/460750.korruption-limbach-macht-halbe-rolle-rückwärts.html?
Sönke Iwersen/Volker Votsmeier: „Chef-Ermittlerin Brorhilker bekommt plötzlich mehr Macht“, Handelsblatt (Online) vom 12. Oktober 2023
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex/cum-ex-skandal-chef-ermittlerin-brorhilker-bekommt-ploetzlich-mehr-macht/29440496.html
Oliver Stock (Gastautor: Reinhard Schlieker): „Der seltsame Rückzieher des grünen NRW-Ministers – Scholz muss wieder zittern“, Focus Online vom 9. Oktober 2023
https://www.focus.de/finanzen/news/cum-ex-ermittlungen-der-seltsame-rueckzieher-des-gruenen-nrw-ministers-scholz-muss-wieder-zittern_id_221528190.html
„CumEx-Täter*innen nicht davonkommen lassen“, Mitteilung von Finanzwende e.V. vom 13. Oktober 2023
https://www.finanzwende.de/themen/cumex/cumex-taeterinnen-nicht-davonkommen-lassen/