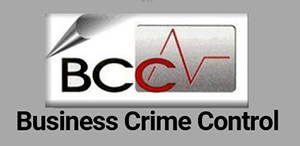„Frankfurt liest ein Buch“ – seit 2010 findet in Frankfurt am Main jährlich im April ein Lesefest mit einer Vielzahl von Veranstaltungen statt. Ausgewählt werden dafür Romane, die in der Stadt spielen und zeitgeschichtliche Relevanz besitzen. „Im 16. Jahr rückt das Lesefestival erstmals Frankfurts Rolle als Finanzplatz in den Vordergrund: Spiegel-Chefredakteur Dirk Kurbjuweits 2004 erschienener Roman ‚Nachbeben‘ liefert eine literarische Chronik der 1990er Jahre und der deutschen Währungsgeschichte. Setting ist neben Frankfurt vor allem der Kleine Feldberg, wo ein Seismograph die Wellen und Schwingungen der großen Welt genauso wie die Gefühlslagen und (zwischen)menschlichen Spannungen des Romanpersonals einfängt.“ So ein Text des Kulturfonds Frankfurt RheinMain zum diesjährigen Event.
In einer Rezension des Romans nach seinem Erscheinen hieß es in der „taz“, dem Autor sei es gelungen, „deutsche Währungs- und Wissenschaftsgeschichte ebenso kurzweilig abzuhandeln wie die darin eingebettet verlaufenden Regungen seiner fünf Hauptakteure“. Ähnlich positiv der Tenor anderer Rezensionen und in diesem Jahr die Berichte über die Lesungen an vielen Orten Frankfurts.
Warum er außer seiner Tätigkeit als Journalist noch Literatur verfasse beantwortete Kurbjuweit in einem Interview wie folgt: „So wird die Fiktion zur Möglichkeit, die ganze Wahrheit zu sagen.“ An diesem nicht eben geringen Anspruch muss er sich messen lassen.
Nehmen wir als Beispiel diejenigen Passagen in seinem Roman, die sich auf die Währungsreform von 1948 beziehen. Man darf erwarten, dass Kurbjuweit – auch weil er Volkswirtschaft studiert hat, also Experte ist – hier nicht nur die sattsam bekannte Legende wiederholt, dass „alle mit 40 Mark angefangen haben“, die sie sich in Form von in den USA frisch gedruckten Scheinen bei den Verteilstellen in den westlichen Besatzungszonen abholen durften. Mit dieser Legende beginnt die Mär vom Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit, bei dem angeblich alle in gleicher Weise profitierten. Wenn dann die einen bald mehr hatten und zu Reichtum kamen, und die anderen weniger, dann lag das an ihrer Leistung und ihrem unternehmerischen Geschick, denn es hatten ja angeblich alle mit der gleichen Summe Geld angefangen.
So stand es jahrzehntelang in den Schulbüchern und so steht es mehr oder weniger auch in Dirk Kurbjuweits Roman. Zwar beschreibt er, wie mit dem neuen Geld schlagartig wieder die Schaufenster voll waren, weil die Geschäftsinhaber illegaler Weise ihre Waren bis zum Tag X gehortet hatten. Er kennt und benennt also das Geheimnis des Sachwerts. Aber dass bei der Umstellung der Währung damals die Guthaben der kleinen Sparer im Verhältnis von 10 zu 1 abgewertet wurden, während die Besitzer von Sachwerten – Grund und Boden, Immobilien, Kapital und Aktien – völlig ungeschoren davonkamen, verschweigt er.
In einem 1981 erschienenen Sammelband zur Geschichte der IG Metall hieß es dazu: „Die Währungsreform … war eine der radikalsten Enteignungen unseres Jahrhunderts, freilich zuungunsten des kleinen Mannes. Mit ihr begann die Vermögenskonzentration in den Händen weniger und die Vermögenslosigkeit breiter Schichten, die heute das Bild der Wirtschaft bestimmen“. Seither hat sich an der Ungleichheit der Vermögen nur geändert, dass sie noch krasser geworden ist.
Auch die Bundeszentrale für politische Bildung bemüht sich inzwischen um eine wahrheitsgetreue Aufklärung über die Währungsreform. In ihrer Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“ hieß es dazu am 29. Juni 2018: „Der Währungsschnitt fiel erheblich schärfer aus, als geplant war, und bedeutete eine große soziale Ungerechtigkeit, da er einseitig die Sparer traf und die Sachwertbesitzer schonte. Ein entsprechendes Lastenausgleichsgesetz kam erst 1952 zustande und zeigte die Schwierigkeit, hier eine angemessene Lösung zu finden.“
Als dies bei einer sich an die Lesung aus dem Roman anschließenden Diskussion vorgetragen wurde, meinte jemand aus dem Publikum, es handele sich doch um Belletristik, nicht um eine volkswirtschaftliche Abhandlung. Der Vorwurf, bei der Währungsreform höchstens die halbe Wahrheit erzählt zu haben, treffe also für Kurbjuweit nicht zu. Dem widersprach eine Teilnehmerin, die auch darauf hinwies, dass die im Roman ständig bemühte metaphorische Parallelisierung von seismischen Erschütterungen durch Erdbeben und gesellschaftlichen Erschütterungen durch Geldreformen unter einem gewissen Ideologieverdacht stehe: Sollen hier etwa ökonomische und soziale Ereignisse als quasi natürliche Phänomene assoziiert werden, die nun einmal passieren? So sagt Kurbjuweit es nicht, aber so könnte es verstanden werden.
Dass mit der einseitig von den Westalliierten verkündeten Währungsreform von 1948 die Teilung Deutschlands besiegelt war, findet er nicht einmal der Erwähnung wert. Bei der Darstellung der Währungsunion von 1990, die dann der erste Schritt zur „Wiedervereinigung“ war, sprich zur Eingemeindung der DDR in die Bundesrepublik, deutet er zwar an, welche verheerenden Konsequenzen ihre Umsetzung für die Konkurrenzfähigkeit der ostdeutschen Unternehmen hatte. Er verliert aber kein Wort über das unselige Wirken der Treuhandanstalt, die mit dem Ziel gegründet worden war, das „Volkseigentum“ der DDR zu Geld zu machen.
In einem Artikel auf der Seite des Mitteldeutschen Rundfunks unter dem Titel „Wie die Treuhand den Osten verkaufte“ heißt es dazu: „Unter teils dubiosen Umständen verscherbelt die Treuhand rund 50.000 Immobilien, knapp 10.000 Firmen und mehr als 25.000 Kleinbetriebe. Dass sie in zahllosen Fällen weder die Bonität der Käufer prüfte noch die Einhaltung der Verträge überwachte, ist aktenkundig. Die DDR gilt in diesen Jahren als ein riesiger Schnäppchenmarkt und die Kritik an dem Gebaren der Treuhand wächst von Jahr zu Jahr… Die Geschichte der Treuhand ist aber vor allem eine Geschichte einer gigantischen Umverteilung: Das einstige Volkseigentum ist zu 85 Prozent an Westdeutsche, zu 10 Prozent an internationale Investoren und nur zu knapp 5 Prozent an Ostdeutsche übertragen worden.“ (7. April 2022)
Im Roman „Nachbeben“ ist davon nicht die Rede, stattdessen wird die Sehnsucht und „Gier“ der Ostdeutschen nach der kaufkräftigen D-Mark herausgestellt. Und bei den Passagen zur Einführung des Euro geht es dann folgerichtig auch um die „harte Mark“, des Deutschen angeblich liebstes Kind, das er nicht gerne gegen eine weiche internationale Währung tauschen möchte.
Die Hauptfigur des Romans, Lorenz, ist ein sozialer Aufsteiger, der bei der Bundesbank Karriere machen möchte. Auf einer internationalen Konferenz tritt er kühn gegen den Euro auf, wird von einem Vorgesetzten gemaßregelt und darüber belehrt, dass „die Franzosen“ nun einmal diesen Preis für die Zustimmung zur deutschen Einheit verlangt hätten. Man werde aber alles dafür tun, den Euro ebenso hart wie die Mark zu machen.
Auch hier kein weiteres Wort mehr darüber, wie die deutsche Wirtschaft dann von der neuen Währung profitierte, ihre Exporte in andere europäische Länder steigern konnte. Stattdessen wird ausgebreitet, wie Lorenz in der Bundesbank gemobbt wird, sich aus Geldnot korrumpieren lässt, woraufhin man ihn schließlich hinauswirft.
In Interviews wurde Dirk Kurbjuweit stets nach seiner persönlichen Meinung zum Euro gefragt. Da distanzierte er sich dann von den Auffassungen seiner Romanfigur. Aber im Roman selbst werden die nostalgischen und national aufgeladenen Mythen um das deutsche Geld nur immer wieder zitiert und allenfalls leicht ironisiert, nicht kritisch auseinander genommen. Zum Beispiel indem die monetären Fragen auch als soziale Fragen, als Fragen nach der Verteilung immer wieder neu gestellt und dargestellt würden.