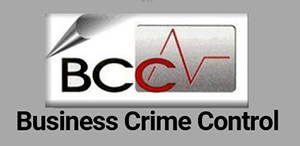Was tun gegen die Politik der Angst?
Auf der ersten Seite seines neuen Buches „Das Haus der Gefühle“ zitiert Harald Welzer den bei uns wenig bekannten französischen Philosophen Gaston Bachelard, auf der zweiten Alexander Kluge. Beide sprechen vom „Haus der Gefühle“ als eigentlichem Zentrum unseres Lebens. Das setzen sie, setzt Welzer gegen das einseitig rationalistische Missverständnis der europäischen Aufklärung, wonach wir nur sind, weil wir denken (cogito ergo sum). Dieser „hochfunktionale Irrtum“ von Descartes und anderen Aufklärern habe „die Trennung zwischen dem Subjekt und dem Rest der Welt“ bedeutet und es „historisch erst möglich (gemacht), in jenes Ausbeutungsverhältnis zur Natur und zu anderen Menschen zu treten, das ein paar Jahrhunderte lang so extrem erfolgreich war und gigantische Fortschritte in fast allen Bereichen menschlichen Lebens erbrachte“.
Inzwischen sind die „Risiken und Nebenwirkungen“ dieses Ausbeutungsmodells immer sichtbarer geworden. Welzer schreibt dazu: „Die Verfügbarmachung der Welt ist ein Prozess, der wirtschaftlich und kulturell geformt ist, aber tatsächlich nicht ad libitum fortsetzbar ist, weil die Natur sich jetzt sicht- und fühlbar der Verfügung entzieht und mit radikal Unverfügbarem – Starkregen, Überschwemmungen, Tornados, Dürren, Bränden – in bis dato ungekanntem Ausmaß antwortet.“ (S. 124) Friedrich Engels sprach schon im 19. Jahrhundert in seiner „Dialektik der Natur“ davon, dass diese sich für jeden „menschlichen Sieg“ über sie „an uns räche“.
Vor allem mit Beispielen aus der Alltagskultur belegt Welzer die negativen Folgen einer auf scheinbar unbegrenztes Wachstum und ständige Erneuerung setzenden Ökonomie: Weitgehend sinnbefreites Shoppen, immer mehr haben wollen, immer schnellere Mode- und Produktzyklen, immer größere Vereinzelung und Abschottung gegen „analoge“ Kontakte durch den exzessiven Gebrauch von Smartphones und Laptops sind Zeichen eines Niedergangs, der uns immer noch als Fortschritt verkauft werden soll.
Welzer spießt mit einiger Lust an der Polemik die „Heilsversprechen des Innovationsfaschismus“ (S. 124) auf, den Optimierungswahn und andere Auswüchse des zeitgenössischen Konsumismus. Aber es bleibt bei ihm nicht bei einer Kulturkritik, der sich im Zweifel auch Konservative oder gar noch weiter rechts stehende Kreise bedienen könnten. Er macht nicht die „menschliche Natur“ oder psychologische Gegebenheiten, also anthropologische Konstanten für die Verhältnisse verantwortlich – so sei der Mensch nun einmal, auf Besitz von Dingen und ständigen Lustgewinn aus. Sondern er nennt Ross und Reiter, nennt unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem beim Namen und zitiert dazu eine entscheidende Stelle bei Marx: „Die kapitalistische Produktion entwickelt … nur die Technik und die Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter“. (S. 211) Die Verwertung und Anhäufung von Kapital bedingt nicht nur ständige Lohndrückerei und Verarmung auf der anderen Seite, sondern auch eine wachsende Umweltzerstörung, sofern ihr nicht Einhalt geboten wird.
Diesem dialektischen Widerspruch in der kapitalistischen Industrieproduktion entspreche in den geistigen Sphären die „Dialektik der Aufklärung“, wie sie Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in ihrem berühmten Buch entfaltet haben. Das beginnt so: „Seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils“. (S. 207 f.) Warum diese geradezu paradoxe Entwicklung? Das Programm der Aufklärung sei die „Entzauberung der Welt“ gewesen. Die unbezweifelbaren Fortschritte an Erkenntnissen und Techniken, die dabei erzielt worden seien, wurden und werden aber erkauft mit einem instrumentellen Verhältnis zu Mensch und Natur: „Die Menschen bezahlen die Vermehrung ihrer Macht mit der Entfremdung von dem worüber sie die Macht ausüben“, heißt es bei Horkheimer und Adorno. Welzer resümiert zugespitzt: „Die entzauberte Welt bietet keinen Raum für Großzügigkeit, Gelassenheit, Fehler, Ambivalenz. Sie ist eine totalitäre Funktionshölle, geleitet von selbstermächtigten Teufeln.“ (S. 212)
Bei diesem pessimistischen, oder wie es heute vorzugsweise heißt: dystopischen Bild von den gegenwärtigen Verhältnissen oder ihrer weiteren Entwicklung macht Welzer nicht Halt. Es soll und kann nicht über Entgegenstehendes hinwegtäuschen: „Unser Dasein bleibt bei allen wissenschaftlichen Fortschritten leider ungeklärt, genauso wie das Unverfügbare… Es ist mehr in der Welt, als sich, mit Shakespeare, die Schulweisheit träumen lässt, es gibt eine Unmenge Geschehnisse, zu deren Erklärung man auf ziemlich unscharfe Dinge wie ‚Zufall‘ oder ‚Schicksal‘ und auf Konzepte wie Glück oder Pech zurückgreifen muss.“ (S. 214) Auch technologisch noch so ausgefeilte Programme, alles in den Griff zu bekommen und unter Kontrolle zu bringen, haben ihre Grenzen und stoßen an sie. Als erstes Beispiel für das „Unverfügbare“ führt Welzer dann nicht zufällig an: „Gänsehaut beim Betrachten eines Kunstwerks“. Die emotionale Wirkung von Kunst ist ebenso wenig rationalisierbar wie die Kunst selbst.
Die Widerspruchs- und Widerstandspotenziale sind also im Alltag selbst zu finden. Die Frage ist, ob sie erkannt werden und wie mit ihnen umgegangen wird. Und hier hat, um auf ein wesentliches Thema des Buches zu kommen, die politische Rechte nach Welzer die Nase vorn. Sie reagiert auf die „Entzauberung der Welt“, auf den Rationalisierungswahn und andere „Segnungen“ der Moderne auf ihre Weise: Mit dem Ruf „Zurück zu den Wurzeln“, zum angeblich „Natürlichen“ und „Normalen“ – auch wenn es trügerischer oder fauler Zauber ist. Damit spricht sie die Gefühle vieler Menschen an, nicht nur die der sogenannten „Modernisierungsverlierer“ in der unteren Hälfte der Gesellschaft. In einer Situation wachsender Ungewissheit, angesichts schon realer oder drohender Klimakatastrophen und Kriege werden Angst und Sorge und die Sehnsucht nach einem sicheren Ort zu vorherrschenden Gefühlen.
Die Rechtspopulisten und Rechtsextremen reagieren darauf nicht mit humaner Ansprache, um Ängste zu dämpfen und Auswege zu zeigen, sondern sie schüren die Angst noch. Um dann angeblich Schuldige zu benennen, Sündenböcke für alles Schlechte, die man auf allen Ebenen bekämpfen und hassen müsse. Dazu dann das Versprechen, die „Heimat“ mit ihrer angeblichen Geborgenheit und früheren Größe wieder zu gewinnen – „Erobern wir uns Deutschland zurück“; „Make America great again“.
Das erinnert an die Jahre der „Weltwirtschaftskrise“ ab 1929 mit dem Aufstieg des Faschismus in Deutschland und in anderen Ländern. Welzer schreibt dazu: „Schon Philosophen wie Theodor W. Adorno oder Ernst Bloch hatten vor dem Hintergrund der Erfahrungen der 1930er Jahre darauf hingewiesen, dass faschistische Agitatoren Erfolge und Bindungskräfte durch das Ansprechen der Gefühle und Zugehörigkeitswünsche ihres Publikums hervorbrachten, während ihre kommunistischen Antipoden mit Zahlen und Argumenten zu überzeugen versuchten. Deshalb waren die einen erfolgreich und die anderen nicht.“ (S. 249) Bloch analysierte das in seinem 1935 zuerst erschienenen Buch „Erbschaft dieser Zeit“.
Die Situation heute ist anders, sie ist trotz mehr Massenkonsum und (noch) einigermaßen funktionierendem Sozialstaat in mancher Hinsicht sogar problematischer: „Heute operieren die Algorithmen der sozialen Netzwerke als Gleichschaltung der Vereinzelten in je für sie individualisierten und personalisierten Blasen, eine noch viel mächtigere Waffe als Goebbels sie hatte, weil niemand einsam sein möchte und jeder serviert bekommt, worauf er abfährt… In einer atomisierten Wirklichkeit suchen die Gefühle ungebunden und haltlos nach Anschluss; sie haben heute nicht mal mehr den Anschluss, den ihnen Kirche oder Gewerkschaften, Kommunisten und Sozialdemokraten in den frühen 1930er Jahren noch gegeben haben und der doch nicht hinreichend war für genug Widerstand gegen den aufkommenden Faschismus. Und wieder wird der Fehler gemacht, die Macht der Gefühle zu unterschätzen.“ (S. 250 f.)
Welzer wirft dies nicht nur den Parteien auf der linken Seite des politischen Spektrums vor, sondern auch neu entstandenen und inzwischen schon wieder abflauenden Bewegungen wie „Fridays for Future“. Stattdessen bringt er in seinem Buch eine Vielzahl von Hinweisen und kleinen Beispielen dafür, was gut ist und was geschehen müsste, um negativen Tendenzen entgegenzusteuern und solidarische Verhaltensweisen zu stärken: „Wenn in einer Gesellschaft Gefühle von Beheimatung, Zugehörigkeit, Willkommensein gegeben sein sollen, ist es unabdingbar, dass es offene Orte gibt, an denen sich Menschen anlasslos treffen und aufhalten können. In Skandinavien, wo man sich seit jeher für die Qualität der öffentlichen Orte als Orten der Vergemeinschaftung interessiert, entdeckt man seit Jahren die Bibliotheken als Community Places neu, wo nicht nur Bücher gelesen oder entliehen, sondern vielfältige Angebote gemacht werden.“ (S. 241)
Ein weiteres Beispiel: „Der amerikanische Soziologe Ray Oldenburg nannte Kneipen, Biergärten, Cafés usw. die ‚dritten Orte‘ (neben Wohnung und Arbeitsplatz), in denen man zwanglos zusammenkommen kann und in denen vor allem die festgelegten Rollen, wie sie in Familie und Beruf definierte sind, sich verflüssigen können.“ (S. 244) Der Begriff „dritte Orte“ erinnert an Bertolt Brechts „dritte Sache“ – etwas, das zwischen Menschen Beziehungen stiften kann, weil es die jeweiligen individuellen Festlegungen zu transzendieren in der Lage ist und Kommunikation ermöglicht. Seien es gemeinsame Projekte oder auch nur geteilte Vergnügen.
In ihrem Artikel „Der Bastard demokratischer Politik“ zitiert Bascha Mika, die ehemalige Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, einige Autor:innen, die ähnlich wie Harald Welzer ein Umdenken bei der Verteidigung der Demokratie gegen ihre Verächter fordern. Welzer beschreibe „Emotionen nicht als private Regungen, sondern als gesellschaftliche Deutungsmuster“. Gefühle seien für ihn „kollektive Speicher: Sie bewahren Erfahrungen, Erzählungen, historische Prägungen. ‚Das sind die Logiken unserer inneren Landschaften. Und die bilden dann unsere Weltbeziehungen – deshalb sind sie politisch.‘ Emotionen seien wie Häuser, in denen Gesellschaften ihre Erinnerungen und Zukunftsbilder unterbringen. Politische Akteure greifen auf diese emotionalen Speicher zu – bewusst oder unbewusst. Dennoch hat es demokratische Politik lange versäumt, eigene emotionale Narrative zu pflegen. Sie hat erklärt, aber nicht erzählt. Rechte Politik hingegen arbeitet gezielt mit solchen Gedächtnisräumen: Bedrohungserzählungen, Verlustängsten, Nostalgie“. (Frankfurter Rundschau vom 2. Januar 2026)
Die Antwort darauf kann aber nicht nur in der Form der emotionalen Ansprache bestehen, sondern sie müsste auch andere politische Inhalte vermitteln, sich auf die tatsächlichen, zu eruierenden Interessen und Bedürfnisse der Menschen beziehen und sie darin bestärken, selbst für sie einzutreten. Das kommt bei Bascha Mika und ein wenig auch bei Harald Welzer zu kurz.
Harald Welzer: Das Haus der Gefühle. Warum Zukunft Herkunft braucht. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2025, 303 Seiten, 25 Euro