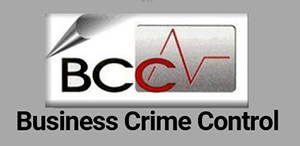Nach Angaben des Manager-Magazins flossen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mehr als sieben Milliarden Euro in deutsche Start-ups – mehr als die Summe, die im gesamten letzten Jahr erreicht wurde. Investoren haben die Gründerszene in Deutschland kaum jemals so umfangreich mit Wachstumskapital versorgt wie derzeit. Das Volumen der Finanzierungsdeals steigt dabei ebenso rasch an wie die Bewertungen der Jungunternehmen. Deutschland weist inzwischen 23 sogenannter Einhörner („Unicorns“) auf, also Firmen mit einem Wert von mehr als einer Milliarde Dollar, die nicht an der Börse notiert sind (vgl. Manager Magazin vom 24. Juni 2021).
Eines der bestfinanzierten Start-ups in Deutschland ist „Gorillas“, ein Berliner Lebensmittellieferdienst, der erst im vergangenen Jahr gegründet wurde. Dieser konnte noch im April dieses Jahres 245 Millionen Euro einsammeln und wird mittlerweile mit einer Milliarde Dollar bewertet (vgl. Manager Magazin vom 10. Juni 2021). Das Unternehmen wirbt damit, online bestellte Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs in zehn Minuten per Fahrrad an die Wohnungstür zu liefern – mit einer festen Liefergebühr von lediglich 1,80 Euro. Die Fahrer*innen („Riders“) erhalten dafür einen Stundenlohn von 10,50 Euro. Mittlerweile gibt es das Unternehmen in Berlin, sowie in weiteren 17 deutschen Städten und vier anderen europäischen Ländern. Möglich wurde der rasante Expansionskurs offensichtlich nur, weil „Gorillas“ massiv von den Anti-Corona-Maßnahmen profitierte.
Gar nicht ins Konzept des Managements passen deshalb die Proteste Dutzender Fahrradkuriere, die ab dem 9. Juni in Berlin eine Streikwelle starteten, nachdem einem Mitarbeiter in der Probezeit gekündigt worden war. Dabei wurden mehrere dezentral in der Stadt verteilte Warenlager blockiert. Die im „Gorillas Workers Collective“ organisieren Aktivist*innen wandten sich mit ihrer Aktion gegen prekäre Arbeitsbedingungen und stellten drei Forderungen auf: Der entlassene Kollege sei sofort wieder einzustellen, die sechsmonatige Probezeit abzuschaffen und es dürfe keine Kündigungen ohne vorherige Abmahnungen geben.
Es folgen Auszüge aus Medienberichten zum (gesellschafts)politischen Hintergrund des Streiks:
„Das Märchen von der großen Familie: Gorillas hatte sich in den vergangenen Monaten auffallend intensiv um Imagepflege bemüht: Die Arbeitsverhältnisse seien nicht prekär, wie bei anderen Lieferdiensten, sondern sicher. Parallel wird die Start-up-Ideologie hier aggressiv verbreitet, wie man es eben kennt: Man sei wie eine große Familie, alles geschehe auf Augenhöhe, gemeinsam arbeite man an einer Unternehmenskultur, in der sich alle wohl fühlen könnten.“
Quelle: Jan Ole Arps/Nelli Tügel: „No more Probezeit“, ak (analyse & kritik) Nr. 672 vom 15. Juni 2021
https://www.akweb.de/bewegung/no-more-probezeit-wilder-streik-bei-lieferdienst-gorillas-in-berlin/
„Viele der Rider leben noch nicht lange in Deutschland und haben die durchregulierten deutschen Arbeitskampfbeziehungen noch nicht verinnerlicht. Manche bringen Erfahrungen mit politischem oder gewerkschaftlichem Widerstand aus anderen Teilen der Welt mit. Dass in Deutschland Streiks, zu denen keine ‚tariffähige‘ Gewerkschaft aufruft, nicht legal sein sollen, leuchtet ihnen nicht ein. (…) Groß ist auch der Kontrast zur Start-up-Rhetorik, die das Gorillas-Management bemüht. In dieser Sprache sind alle Rider und Picker eine ‚Familie‘, eine ‚Community‘ und Teil einer ‚Bewegung‘.“
Quelle: Nelli Tügel/Jan Ole Arps: „Riders in ‘nem Sturm“, Der Freitag vom 24. Juni 2021
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/riders-in-2019nem-sturm
„Lieferdienste stehen seit Jahren im Zentrum von Aktionen von gewerkschaftsnahen Gruppen. Bei Amazon versucht die Gewerkschaft Verdi seit vielen Jahren, das Unternehmen mit Streikaktionen in den Einzelhandels-Tarifvertrag zu drängen. Auch gegen Lieferando machen Aktivisten seit Jahren mobil. Jetzt gerät Gorillas als bekanntester der neuen, schnellen Lieferdienste ins Visier. Organisator der Proteste ist offenbar die Gruppe ‚Gorillas Workers Collective‘, die mit der Gastro-Gewerkschaft NGG und der anarchistischen Gewerkschaft FAU kooperiert. (…) Für Gorillas kommen die Proteste zu einem heiklen Zeitpunkt: Nach einer Finanzierung über 245 Millionen Euro im März ist das Unternehmen laut mehreren Berichten erneut dabei, Geld einzusammeln. Diesmal soll es um zwei- bis viermal so viel Geld gehen. Damit will Gründer Sümer das rasante Wachstumstempo des kaum zwei Jahre alten Start-ups aufrechterhalten – und gegen die Konkurrenz ankommen. Zuletzt erhielt der Klon Flink eine ähnlich hohe Finanzierung und Rückendeckung von Rewe. Zudem stehen mehrere große Konkurrenten wie Delivery Hero und Getir aus der Türkei in den Startlöchern für eine Expansion ihrer Lebensmittellieferdienste in Deutschland.“
Christoph Kapalschinski: „Wilde Streiks in Berlin: Fahrer gefährden das Image des App-Supermarkts Gorillas“, Handelsblatt vom 10. Juni 2021
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/start-up-wilde-streiks-in-berlin-fahrer-gefaehrden-das-image-des-app-supermarkts-gorillas-/27273432.html
„Zum einen sehen wir in Deutschland wie in anderen europäischen Ländern auch eine schleichende Deregulierung von Arbeitnehmerrechten, die dazu beigetragen haben, dass es überhaupt möglich ist, Mitarbeiter wie die von Lieferdiensten zu ultraprekären Bedingungen anzustellen. Während das Thema Arbeit in Europa ob Schulden- und Coronakrise unter Druck steht, wurde die ‚Flexibilisierung‘ des Arbeitsmarktes hierzulande ein Jahrzehnt früher auf den Weg gebracht. Wir erinnern uns, Deutschland galt einmal als ‚kranker Mann‘ Europas. Daraus folgte: die Agenda 2010.
Zum anderen sehen wir dieser Tage, wie Wirtschaft und Politik sich gleichsam mühen, Frauen für Führungspositionen zu mobilisieren. Das ist gut und überfällig – wird aber im Moment nur für einen Teil der Gesellschaft gedacht: die Besserverdienenden. Ihnen gegenüber steht ein Apparat an Niedriglohnarbeitenden. In Deutschland wird jeder Fünfte Arbeitnehmer diesem Sektor zugerechnet. Darin noch gar nicht berücksichtigt, die schwarz arbeiten. Wenn in Haushalten Arbeiten wie Putzen, Waschen, Einkaufen oder Kinderbetreuung nun wegen hoher Arbeitsbelastungen im Job von zum Beispiel zwei Elternteilen nicht mehr erledigt werden können, werden sie ausgelagert – und zwar zu im Vergleich oft prekären Arbeitsbedingungen.
Das ist eine Entwicklung, die wir bereits vor der Pandemie gesehen haben, die aber während ihres Verlaufs noch deutlicher wurde: Im Grunde arbeiten wir so viel, dass wir uns um die Dinge des Alltags kaum mehr selbst kümmern können. Daraus folgt: die Renaissance der Dienstbotengesellschaft. Das kann man so halten, aber dann gilt es, die Arbeitsbedingungen derer zu achten und zu guten Konditionen zu gestalten, die stattdessen für uns anrücken, unser Privatleben bequemer einzurichten. Der Protest der Gorillas-Fahrer ist insofern zu verstehen. Wir sollten ihn unterstützen.“
Quelle: Katharina Brienne: „Zum Arbeitskampf bei Gorillas: Die Rampe des Aufstiegs ist der Verrat“, Berliner Zeitung vom 15. Juni 2021
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/die-rampe-des-aufstiegs-ist-der-verrat-li.164915
„Von ‚digitaler Sklaverei‘ spricht hingegen die SPD-Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe aus Friedrichshain-Kreuzberg. Schon länger befasst sie sich mit den Arbeitsbedingungen in der Branche. Kiziltepe wirft Unternehmen wie Gorillas vor, Wachstum auf dem Rücken der Beschäftigten zu erzwingen. Gorillas wisse über die App, über die auch der Bestellvorgang abgewickelt wird, immer, wo sich ein Fahrer gerade befindet. Das baue Druck auf, um die Beschäftigten zu drillen. ‚Dass einem Mitarbeiter wegen einer einmaligen Verspätung gekündigt wird, ist rechtlich zwar möglich, wirft aber kein gutes Licht auf das Unternehmen‘, sagte Kiziltepe der Berliner Zeitung. Die SPD-Politikerin hat einen Brief an Gorillas-CEO Sümer geschrieben. Darin fordert sie ihn auf, die Kündigung des Fahrers zurückzunehmen – und die Regeln der betrieblichen Mitbestimmung zu akzeptieren. (…) Kiziltepe spielt damit auf die Vorgeschichte der Eskalation bei Gorillas an. Um einen Betriebsrat zu gründen, haben die Beschäftigten Anfang Juni zunächst einen Wahlvorstand gewählt. Diese Hürde sieht das Gesetz vor. Doch das Management will die Wahl gerichtlich überprüfen lassen. Nicht alle Angestellten, so die Begründung, konnten an der Abstimmung gleichberechtigt teilnehmen. Die Mitarbeiter, die sich im ‚Gorillas Workers Collective‘ organisiert haben, halten dieses Argument für vorgeschoben. Sie verweisen auf Verhinderungsversuche des Unternehmens – und das per se problematische Geschäftsmodell von Gorillas.“
Quelle: Fabian Hartmann: „Streik bei Gorillas: Das steckt hinter dem Aufstand beim Liefer-Giganten“, Berliner Zeitung vom 14. Juni 20021
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/streik-bei-gorillas-das-steckt-hinter-dem-aufstand-beim-liefer-giganten-li.164878
„Die Dienstbotifizierung macht vor nichts halt, auch nicht vorm Supermarkt. Lieferdienste wie ‚Gorillas‘ sind der letzte Schrei des Start-up-Irrsinns. (…) Früher haben die Leute Holz gehackt und ihre Butter selbst gemolken. Sie sind vor wilden Tieren um ihr Leben gerannt. Heute sendet ‚Gorillas‘ auf Plakaten einen ‚Gruß an alle, die morgens um 8 h Bio-Gurken aus der Region bestellen‘. (…) Wohin das alles führt, ist eine gute und sogar ernst gemeinte Frage. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass sich Akademiker:innenpärchen eine sprechende Lautsprecherbox ins Wohnzimmer stellen? Folgt auf ‚Alexa‘ bald ‚Rettich‘, der das leider nicht mitlieferbare Supermarktfeeling ganz bequem ins Eigenheim trägt? Hängen sich Hipster bald Einkaufswagen an die Wand, voll retro?“
Quelle: Adrian Schulz: „Rückkehr zum Planet der Affen“, taz vom 16. Juni 2021
https://taz.de/Lieferdienste-fuer-Lebensmittel/!5774556/
„Die ‚Rider‘, also die Fahrradkuriere, von Gorillas verdienen nur knapp über dem Mindestlohn und sind aufgrund der überambitionierten Lieferzeit und Arbeitsbedingungen wie aus dem Frühkapitalismus nicht gerade ein begehrter Traumjob. In einem funktionierenden Arbeitsmarkt gäbe es gar nicht genügend Interessenten, die sich auf diesen Knochenjob zu diesen Konditionen einlassen würden. Die Corona-Maßnahmen haben jedoch gerade in den Großstädten vor allem in den prekären Jobs gewütet, aus denen Lieferdienste wie Gorillas im letzten Jahr ihr Personal rekrutierten – Aushilfsjobber aus der Gastronomie, oft Migranten, die kaum Deutsch sprechen; nicht umsonst ist Englisch die Betriebssprache bei Gorillas. Auch zahlreiche Studenten sind unter den Mitarbeitern, also größtenteils jüngere Menschen, für die während der Maßnahmen-Krise kein soziales Netz gespannt wurde und die aufgrund ihrer prekären Arbeitsverhältnisse auch nicht von Kurzarbeit oder sonstigen staatlichen Hilfen profitieren konnten. Die Maßnahmen und die Weigerung der Politik, Opfern der Maßnahmen zu helfen, die in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind, haben das Geschäftsmodell des Quick-Commerce, so bezeichnen sich diese Dienste, eröffnet.
Finanziert wird die atemberaubende Expansion dieser Unternehmen vornehmlich durch Risikokapital; und hier ist der Begriff ‚Risiko‘ durchaus ernstzunehmen. Nachhaltig ist dieses Geschäftsmodell nämlich nicht. Wenn ein Rider einen Stundenlohn von 10,80 Euro bekommt, muss er sechs Kunden pro Stunde beliefern, um nur seinen Lohn über die Liefergebühren von 1,80 Euro pro Bestellung zu erwirtschaften. Schon das ist nicht möglich. Hinzu kommen indirekte Kosten (z.B. die Sozialabgaben) der Beschäftigten, die Kosten für die Logistik – die lokalen Auslieferungslager sind geschäftsmodell-bedingt natürlich auch in den ‚besseren‘ und somit teuren Stadtteilen untergebracht, in denen die Kundschaft lebt. Und so macht Gorillas – internen Dokumenten zufolge, die das Managermagazin ausgewertet hat – mit jeder Bestellung 1,50 Euro Verlust. Das erinnert an eine klassische Blase, die jedoch in der risikokapitalgetriebenen Internet-Ökonomie schon fast normal ist. Man sammelt einen dreistelligen Millionenbetrag von Investoren ein und expandiert trotz roter Zahlen in einem atemberaubenden Tempo mit dem Ziel, das Unternehmen später für einen Milliardenbetrag an einen multinationalen Konzern zu verkaufen oder selbst an die Börse zu gehen und weitere Milliarden Investorengelder einzusammeln. Real wird zwar Geld verbrannt, was aber nicht interessiert, solange der Unternehmenswert losgelöst von der Realität bewertet wird. Irgendwann platzt die Blase zwar, aber wenn dies innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung eines hochprofitablen Multis wie Amazon oder Google passiert, deren Rücklagen schier unermesslich sind, ist dies nur noch eine Randnotiz.
Die eigentlichen Verlierer sind neben den ausgebeuteten Niedriglöhnern die meist als Familien- oder Kleinbetrieb geführten Konkurrenten aus der Realwirtschaft. Während Dienste wie Amazon fresh eher mit den großen Supermarktketten konkurrieren, sind Gorillas und Co. eine Kampfansage an die kleinen Kioske, Büdchen und Spätis, die in der Großstadt der erste Anlaufpunkt sind, wenn man noch eine kleine Besorgung zu erledigen hat. Hat Amazon den klassischen Einzelhandel in den Städten ruiniert, drohen Gorillas und Co. nun den kleinen Geschäften im großstädtischen Bereich den Boden unter den Füßen wegzureißen.“
Jens Berger: „Quick-Commerce – die Rückkehr der Dienstbotengesellschaft“, NachDenkSeiten – Die kritische Website vom 23. Juni 2021
https://www.nachdenkseiten.de/?p=73617
Es folgen Auszüge aus Medienberichten zum Aspekt des „wilden Streiks“:
„Es handelt sich um einen sogenannten wilden Streik, also um einen, der unabhängig von den Gewerkschaften organisiert wurde. Nach derzeitiger Rechtslage sind die Streikenden deshalb nicht vor Kündigungen geschützt. Die Arbeitgeber:innen könnten argumentieren, dass die Arbeiter:innen ihre Seite des Arbeitsvertrags nicht erfüllen. Für Nicht-EU-Bürger:innen hängt der Aufenthaltsstatus ja auch von einer Beschäftigung ab. (…) Wir erleben wilde Streiks insbesondere in Branchen, die von den großen Gewerkschaften nicht abgedeckt werden. Die stark flexibilisierte Online-Ökonomie ist ein Paradebeispiel. Da die Riders kaum eine Möglichkeit haben, legal in Tarifverhandlungen einzutreten, helfen sie sich mit dem Mittel, das ihnen zur Verfügung steht: dem Verweigern ihrer Arbeitskraft. (…) Hierzulande sind Streiks durch Gerichte traditionell stark reglementiert und auch die großen Gewerkschaften haben es sich in ihrer Rolle als Tarifpartner eingerichtet. Die größte wilde Streikwelle gab es in den 1970er Jahren in den Industriebetrieben Westdeutschlands. Interessant ist, dass diese zu überragenden Teilen von Gastarbeiter:innen getragen wurde.
Historisch wurden die Interessen von Gastarbeiter:innen durch die Gewerkschaften nicht oder deutlich schlechter vertreten, sie waren Arbeiter:innen zweiter Klasse. Spannend ist, dass auch bei Gorillas sehr viele migrierte Menschen arbeiten, die sich an den Aktionen beteiligen. Das mag mit den besonders prekären Arbeitsbedingungen von migrierten Menschen zusammenhängen. Oder mit einer politischen Sozialisation außerhalb Deutschlands. (…) In anderen Ländern sind Streiks häufig politischer, ja. Aber wilde Streiks müssen keineswegs revolutionär sein. Die Gorillas-Arbeiter:innen wollen aktuell nichts weiter als leichte Verbesserungen in ihrer prekären Arbeitssituation – sie wollen Reformen. Dennoch wohnt wilden Streiks zumindest ein revolutionäres Moment inne, weil sich Arbeiter:innen an der Basis selbst ermächtigen. Sie vertreten sich ohne Repräsentanzen. Ein wirklich revolutionärer Streik wäre daher vermutlich ein wilder.“
Quelle: Timm Kühn: „Wild bestreikt“, Simon Duncker (Pressesekretariat der unabhängigen Basisgewerkschaft „Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union Berlin“ [FAU Berlin] im Interview, taz vom 16. Juni 2021
https://taz.de/Protest-bei-Lieferdienst-Gorillas/!5775031/
„Wilde Streiks sind spontane Arbeitsniederlegungen ohne gewerkschaftlichen Segen. Sie sind genaugenommen illegal und kommen hierzulande so gut wie nie vor. Der letzte wilde Streik fand vergangenen Sommer statt, als vorwiegend rumänische Erntearbeiterinnen und Erntearbeiter beim Spargelhof Ritter in Bornheim gegen vorenthaltene Löhne vorgingen. Und 2017 schrieben sich auffallend viele Air-Berlin-Pilotinnen und -Piloten gleichzeitig krank, was in der Presse – unzutreffenderweise – als wilder Streik bezeichnet wurde. Ende 2014 legten Daimler-Beschäftigte in Bremen spontan die Arbeit nieder, um gegen Werkverträge zu protestieren; zehn Jahre zuvor gab es den letzten großen wilden Streik in Deutschland: Mehrere tausend Arbeiterinnen und Arbeiter bei Opel Bochum versuchten im Oktober 2004, ihre Arbeitsplätze zu verteidigen. Blickt man noch weiter zurück, bis in die 1970er Jahren, stößt man auf eine Welle wilder Streiks der sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter gegen ihre Überausbeutung, der bekannteste: Fordstreik in Köln. 1973 war das.
Wilde Streiks sind nicht nur spannend, weil sie eine widerspenstige Ausnahme in den Klassenbeziehungen darstellen – in den 1970ern hätte man von Arbeiterautonomie gesprochen –, sondern auch, weil sie häufig von Arbeiterinnen und Arbeitern gestartet werden, die von den Gewerkschaften nicht gut vertreten werden oder sich nicht gut vertreten fühlen. Wenn sie erfolgreich sind, sind sie eine wichtige Inspiration für andere. Da sie sich außerhalb des rechtlichen Rahmens bewegen, sind wild Streikende schlecht vor Repressalien oder Schadensersatzforderungen geschützt. Damit ihr Kampf als positives und nicht als abschreckendes Beispiel endet, ist Solidarität besonders wichtig.“
Quelle: Jan Ole Arps: „Wildcat bei ‚Gorillas‘“, junge Welt vom 15. Juni 2021
https://www.jungewelt.de/artikel/404536.arbeitskampf-wildcat-bei-gorillas.html
„Zu Streiks können laut deutschem Recht nur Gewerkschaften aufrufen. Weder die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), die zunächst auch bei der Betriebsratswahl involviert war, noch Verdi hätten vorab von der Arbeitsniederlegung gewusst oder seien daran beteiligt (…). Die Freie Arbeiter Union (FAU), die vor allem Angestellte der Gig Economy vertritt, wird vom Deutschen Gewerkschaftsbund nicht als rechtmäßige Arbeitnehmervertretung angesehen, sodass auch diese Organisation keine Ermächtigung dazu hat.
Solch ein sogenannter ‚wilder Streik‘ sei eine rechtswidrige Maßnahme, so ein Arbeitsrechtler zu Gründerszene. Solche Proteste habe es in Deutschland seit mehreren Jahren nicht mehr gegeben. Theoretisch gesehen könnte Gorillas daher allen Teilnehmenden fristlos kündigen und sogar Schadensersatz für die ausgefallenen Touren verlangen. Ob das Unicorn diesen Schritt gehen wird, ist aber fraglich. Das würde schließlich kein gutes Licht auf den Lieferdienst werfen, so der Anwalt.“
Sarah Heuberger/Lis Ksienrzyk: „Nach Kündigung eines Kollegen: Gorillas-Fahrer gehen in illegalen Streik“, businessinsider (Nachrichtenportal) vom 11. Juni 2021
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/food/gorillas-streik-fahrer-gekuendigt-b/
„Das deutsche Richterrecht habe eine Handvoll Glaubenssätze über Streiks aufgestellt, die ein knöchernes System bilden und Streikende vor Herausforderungen stellen, erklärt Sylvia Bayram von der Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht gegenüber jW. ‚Allzu gerne wird alles, was nicht in das enge Korsett dieses Katechismus passt, für rechtswidrig erklärt.‘ Ein zentraler Glaubenssatz sei, dass Arbeitskämpfe, zu denen nicht eine Gewerkschaft aufruft, ‚auch spontane oder wilde Streiks genannt, als illegal gelten‘.
Was Bayram meint, wird deutlich, wenn man in die Vergangenheit blickt. Ende 2015 traten die Mercedes-Arbeiter in Bremen in den ‚wilden‘ Streik. Auch hier explodierte scheinbar wie aus dem Nichts eine Bremer Supernova. Das Ende des immer stärker wuchernden Werkvertragssystems und die Festanstellung der Lohnsklaven zweiter und dritter Klasse wurden gefordert. Die Unternehmensleitung mahnte das ‚wilde‘ Streiken ab. Die IG Metall lehnte es ab, den Arbeitskampf nachträglich zu entkriminalisieren.
‚Nach europäischem Recht – genauer: nach der Europäischen Sozialcharta (ESC) – sind wilde Streiks legal‘, so Rechtsanwalt Benedikt Hopmann im Gespräch mit jW. ‚Denn zu Recht betrachtet das europäische Recht die Koalitionsfreiheit als Ausgangspunkt für Arbeitskämpfe. Und in dieser Logik sind nicht nur Gewerkschaften Koalitionen. Auch Gruppen von Beschäftigten eines Betriebes, die sich – vielleicht sogar spontan – zusammentun, um ihre Interessen zu erstreiken, bilden eine Koalition.‘ Hopmann rät, bei wilden Streiks einen Verhandlungspartner für die Gegenseite unter den Streikenden zu benennen.
Bei Daimler entschied Mercedes letztlich, die Abmahnungen vorzeitig aus den Personalakten zu entfernen. Ein Etappensieg. Ein weiterer Glaubenssatz des deutschen Richterrechts, der im Arbeitskampf bei Gorillas relevant sein könnte, ist das Dogma, dass Arbeitskampfforderungen tariffähig sein müssen.
Zwei der insgesamt drei Forderungen des Gorillas-Streiks lassen sich sicherlich problemlos in einen Tarifvertrag gießen, aber die dritte Forderung, die Rücknahme der Kündigung eines Kollegen, eher nicht. Als tiefere Ursache für den Streik benennen die Gorillas-Beschäftigten das gesamte prekäre, menschenfeindliche System bei Gorillas. Die Kündigung ihres Kollegen Santiago war aber nun einmal der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte müssen nicht alle Forderungen zulässig sein. Allein die Tatsache, dass eine Gruppe von Beschäftigten im Betrieb eine Forderung für streikwürdig hält, legalisiert diese, egal, ob tariffähig oder nicht, wenn gleichzeitig auch tariffähige Forderungen aufgestellt werden.“
Quelle: Lukas Schmolzi: „Falsche Glaubenssätze“, junge Welt vom 22. Juni 2021
https://www.jungewelt.de/artikel/404811.wilder-streik-bei-gorillas-falsche-glaubenss%C3%A4tze.html
Weitere Quellen: „Zoff bei Gorillas in Berlin“, Manager Magazin vom 10. Juni 2021
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/tech/gorillas-streik-und-blockaden-beim-lebensmittellieferdienst-in-berlin-a-1515500c-4c6d-4b2b-9c89-1bb85823bfe5
„Die größten Gründerdeals des Jahres“, Manager Magazin vom 24. Juni 2021
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/scalable-trade-republic-celonis-die-groessten-gruenderdeals-des-jahres-a-44686e0a-5b2c-490f-b550-56e4a802ab82
Interessant ist auch folgende Online-Diskussion, in der unter anderem Ramazan Bayram von der „Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht“ den Kampf der „Riders“ in die allgemeine Situation von Arbeitskämpfen der letzten Monate einordnet:
„Riders Unite – Arbeitskämpfe in der Pandemie“, Teil 15 der Reihe „Corona und linke Kritik(un)fähigkeit“ vom 14. Juni 2021
https://vimeo.com/563308641