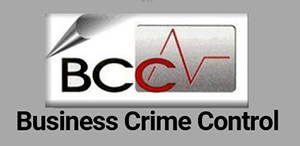Der Niedergang des Immobilienkonzerns Adler Group
Am 28. Juni 2023 führten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt eine Großrazzia gegen die Adler Real Estate durch – deutsche Tochtergesellschaft der in Luxemburg ansässigen Adler Group. Zu den schwerwiegenden Vorwürfen gehören Bilanzfälschung, Marktmanipulation und Untreue. Bei den Ermittlungen geht es um Geschäfte der Adler Real Estate bis zum Jahr 2020.[1]
Mit Bezug auf eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt schrieb die FAZ:
„Ziel der von 175 Beamten durchgeführten umfangreichen Durchsuchung sind demnach insgesamt 21 Geschäftsräume, Wohnungen und eine Rechtsanwaltskanzlei in Berlin, Düsseldorf, Köln und Erfstadt sowie in Österreich, den Niederlanden, Portugal, Monaco, Luxemburg und Großbritannien. Beschuldigt würden deutsche, österreichische und englische Staatsangehörige im Alter zwischen 38 und 66 Jahren. Ihnen werde vorgeworfen als Vorstände des Immobilienunternehmens mit Sitz in Berlin im Zeitraum 2018 bis 2020 die Bilanzen falsch dargestellt oder dazu Beihilfe geleistet zu haben. Zudem sollen sie zum Nachteil des Unternehmens im Namen der Gesellschaft Beraterverträge abgeschlossen haben, für die es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen keine Gegenleistungen gegeben habe.“
Laut Staatsanwaltschaft bestehe daneben der Verdacht, dass die Beschuldigten mit Gefälligkeitsangeboten und Scheingeschäften die Preise für Immobilienprojekte in die Höhe getrieben hätten, um einen günstigen Loan to Value zu erreichen. Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Kreditbetrages am Verkehrswert einer Immobilie an. Durch den verzerrten Loan to Value (LTV), so die FAZ, seien laut Staatsanwaltschaft dem Kapitalmarkt falsche Signale für Anlageentscheidungen sowie zur Höhe des Marktpreises gesendet worden. Das Handelsblatt ergänzt in einem Artikel, dass der LTV für Adler zentral sei: Würden Schwellenwerte gerissen, könnten Gläubiger die Rückzahlung ihrer Anleihen fordern.
Der öffentliche Niedergang des Immobilienkonzerns begann im Herbst 2021, als der britische Leerverkäufer Fraser Perring die Adler Group mit schweren Vorwürfen konfrontierte (Bilanzmanipulation, Geschäfte mit nahestehenden Personen zum Schaden der Investoren). Daraufhin brach der Aktienkurs ein. Im April 2023 wurde berichtet, dass Adler versuche, sich zur Abwendung einer Pleite nach britischem Recht und auf Kosten der Gläubiger zu sanieren (Umstrukturierung von Schulden in Milliardenhöhe) – was auf erheblichen Widerstand bei den Aktionären stieß.
Fabio de Masi, ehemaliges Mitglied des Bundestages für die Partei Die Linke und Finanzexperte, bemerkt zur Adler Gruppe:
„Adler hat eine traditionsreiche Vergangenheit. Die Adler-Werke in Frankfurt am Main wurden zunächst mit Fahrrädern und später mit Schreibmaschinen bekannt. Die Tasten einer solchen Adler-Schreibmaschine wurden etwa von dem verzweifelten Jack Nicholson im 1980er-Jahre Horror-Streifen ‚The Shining‘ des US-Regisseurs Stanley Kubrick in einer ikonischen Szene bearbeitet, wie Der Spiegel vor einiger Zeit erinnerte. Mittlerweile hat Adler nur noch Wohnungen statt Schreibmaschinen. Aber es droht ein Wirtschaftshorror aus Schulden und Bauruinen. Einst verfügte Adler über 70.000 Objekte mit Schwerpunkt Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Darunter etwa der Steglitzer Kreisel in Berlin, das Areal der ehemaligen Holsten Brauerei in Hamburg sowie Objekte im Düsseldorfer Glasmacherviertel. Nunmehr sind es laut Adler ‚nur‘ noch rund 27.500 Einheiten. (…)
Es ist nicht das erste Mal, dass der Konzern in den Schlagzeilen ist. Die Adler Group erlitt im Jahr 2022 einen Verlust von knapp 1,7 Milliarden Euro. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hatte 2021 das Testat für die Bilanzen der Adler Real Estate mit Verweis auf mangelnde Informationen über Geschäfte mit Adler nahestehenden Personen verweigert. Auch eine Bestellung durch das Amtsgericht Charlottenburg für die Bücher des Jahres 2022 lehnte KPMG ab. Sämtliche andere großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hatten das Mandat ebenfalls abgelehnt, bis sich die Wirtschaftsprüfer Rödl und Partner bereit erklärten wenigstens die Adler Real Estate zu prüfen.“
De Masi erkennt – wie viele Brancheninsider – bei der Adler Group ein Netzwerk, welches an den ehemaligen Dax-Konzern Wirecard erinnert. So soll der österreichische Multimillionär Cevdet Caner in dem Immobilienkonzern die Strippen ziehen, ohne ein formales Amt im Konzern zu bekleiden. Caner ist jedoch Chef der Investmentgesellschaft Aggregate Holding, die lange Zeit größter Adler-Aktionär war. Zudem kontrolliert seine Frau bis heute ein größeres Aktienpaket. De Masi beschreibt die dubiose Gestalt Caner im Detail:
„Caner war ehemals bei den Jusos in Österreich politisch engagiert und nahm neben Hertha-BSC-Investor Lars Windhorst und Kaufhauskönig René Benko am Spendendinner für den einstigen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet teil. Er brach sein BWL-Studium ab und gründete 1998 die Call und Logistik Center GesmbH (CLC), die es mit Österreichs erster privater Telefonauskunft an die Wiener Börse schaffte. 2002 verkaufte Caner seine Anteile und das Unternehmen schlitterte kurze Zeit später in die Insolvenz.
Im Jahr 2004 gründete Caner dann den Immobiliendienstleister Level One mit Steuersitz der Holding auf der Kanalinsel Jersey. Level One kaufte etwa das Falkenberger Viertel in Berlin-Hohenschönhausen. Level One profitierte auch von der Privatisierung von landeseigenen Wohnungsbeständen in Nordrhein-Westfalen unter Ex-CDU Ministerpräsident Jürgen Rüttgers. 2008 meldete der Immobilienkonzern für seine deutschen Objektgesellschaften Insolvenz an, nachdem die Banken Level One unter Zwangsverwaltung gestellt hatten. Von der Insolvenz waren rund 20.000 Wohnungen sowie 500 Gewerbeobjekte – mit Schwerpunkt Berlin und Ostdeutschland – betroffen. Level One kollabierte unter 1,2 Milliarden Euro Schulden und galt als größte Immobilienpleite Deutschlands, nach Jürgen Schneiders Konkurs in den 1990er-Jahren. Caner musste sich auch vor dem Landesgericht für Strafsachen Wien mit weiteren Angeklagten wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen schweren Betrugs und Geldwäsche verantworten. Er wurde 2020 jedoch von allen Vorwürfen freigesprochen.“
Die Süddeutsche Zeitung ergänzt, dass Verbindungen und Entwicklungen dieser Art das Vertrauen in Adler inzwischen weitgehend zerstört hätten. Auch der Einstieg von Vonovia als Großaktionär und die Bestellung des ehemaligen Vonovia-Finanzvorstands Stefan Kirsten zum Verwaltungsratschef könnten daran nichts ändern. So hätte der Konzern rund ein Jahr lang niemanden gefunden, der seine Bilanzen hätte prüfen und testieren wollen.
Anmerkung: Auch Branchenführer Vonovia hat derzeit erhebliche Probleme – aber das ist nun wieder eine andere Geschichte (vgl. BIG-Nachricht vom 12. April 2023: „Korruptionsvorwürfe gegen den Skandalkonzern Vonovia“).
Quellen:
Fabio De Masi: „Adler im Sinkflug? Ein Blick hinter die Kulissen eines undurchsichtigen Immobiliengeflechts (Teil 1), Berliner Zeitung (Online) vom 8. Juli 2023
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/adler-group-skandal-ein-blick-hinter-die-kulissen-eines-undurchsichtigen-immobiliengeflechts-fabio-de-masi-li.366941
ders.: „Adler im Sinkflug? Über die Hintergründe eines undurchsichtigen Immobiliengeflechts (Teil 2)“, Berliner Zeitung (Online) vom 10. Juli 2023
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/adler-group-skandal-ueber-die-hintergruende-eines-undurchsichtigen-immobiliengeflechts-teil-2-li.367025
Mark Fehr: „Riesen-Razzia bei Tochterfirma von Adler“, FAZ (Online) vom 28. Juni 2023
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/vorwurf-der-bilanzfaelschung-und-untreue-razzia-bei-adler-group-18995831.html
Stephan Radomsky: „Großrazzia beim Immobilienkonzern Adler“, Süddeutsche Zeitung vom 29. Juni 2023
Michael Verfürden/Lars-Martin Nagel/Volker Votsmeier/René Bender: „Großrazzia bei Adler Real Estate wegen Verdachts der Marktmanipulation“, Handelsblatt (Online) vom 28. Juni 2023
https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/immobilienkonzern-grossrazzia-bei-adler-real-estate-wegen-verdachts-der-marktmanipulation/29229100.html
[1] vgl. auch den BIG-Artikel vom 4. Juli 2022 („Die Adler Group: aktuell Skandalunternehmen Nummer eins in der deutschen Immobilienbranche“)