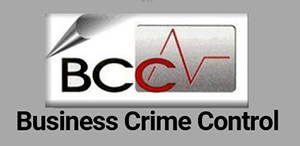Nach langen Auseinandersetzungen einigten sich am 12. Februar 2021 Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf einen Kompromiss zum Lieferkettengesetz. Danach sollen ab 2023 deutsche Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeiter*innen zur Einhaltung von Menschenrechten bei ihren Lieferanten im Ausland verpflichtet werden. Ab 2024 gelten die Regelungen auch für Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten. Durch die Begrenzung soll laut Minister Heil die Wettbewerbsstellung der deutschen mittelständischen Wirtschaft geschützt werden. Geplant ist, den vorliegenden Entwurf bis Mitte März im Kabinett und als Gesetz noch in dieser Legislaturperiode im Bundestag zu beschließen.
Die Bundesregierung hatte sich bereits im Koalitionsvertrag von 2018 verpflichtet, ein Gesetz mit Sanktionen zu verabschieden, sofern nicht eine freiwillige Selbstverpflichtung der deutschen Großunternehmen zur Einhaltung entsprechender Regeln bis zum Jahr 2020 greifen würde. Im Oktober des vergangenen Jahres ergab der Abschlussbericht eines Monitoringprozesses, dass maximal 17 Prozent der befragten Unternehmen freiwillig die Anforderungen erfüllt hatten. Das von der Bundesregierung gesetzte Ziel von 50 Prozent wurde damit weit verfehlt und eine verpflichtende Regelung für die Unternehmen notwendig.
Einige Auszüge aus Pressekommentaren und Stellungnahmen von NGOs zum aktuellen Gesetzesentwurf:
Pepe Egger: „Minimalstandards? Zu teuer!“, der Freitag vom 25. Februar 2021:
„Denn als die Bundesregierung ihrer eigenen Vorgabe folgte und nach dem Scheitern der freiwilligen Selbstkontrolle ein Gesetz zur Sorgfaltspflicht beschließen wollte, begannen die Branchenlobbyisten zu kalkulieren. Die Wirtschaftsvereinigung Metalle will errechnet haben, dass derlei Pflichten jeden Mittelständler mit zusätzlich rund 60.000 Euro jährlich ‚belasten‘. Größere Firmen müssten mit Extrakosten von einer halben Million Euro kalkulieren. Pro Jahr! Man muss der Wirtschaftsvereinigung Metalle dankbar sein. So klar hätte man das selbst nicht sagen können: Absolute Mindeststandards in Lieferketten sind einfach zu teuer. Zusätzliche Kosten in der Höhe des Jahresgehalts sage und schreibe eines zusätzlichen Mitarbeiters sind für Mittelständler doch offensichtlich unzumutbar. Für DAX-Unternehmen wären es rund zehn Prozent des durchschnittlichen Vorstandsvorsitzenden-Gehalts. Eine quasi unmenschliche Belastung! (…) Müller und Heil hatten verlangt, dass Unternehmen auch dafür geradestehen, was in ihren Lieferketten passiert, sprich: zivilrechtlich dafür haften. Doch ‚die Wirtschaft‘ machte da nicht mit: Unternehmen sind nur für ihre direkten Zulieferer mitverantwortlich, haften müssen sie auch nicht. Stattdessen drohen nur mögliche Bußgelder, wenn sie ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachkommen.“
https://www.freitag.de/autoren/pep/minimalstandards-zu-teuer
Thomas Seibert: „Lockdown hier und Elend dort – Textilproduktion, Corona und das Lieferkettengesetz“, express: Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit, Nr. 2/2021:
„Politisch zählt, dass das Gesetz unumgänglich wurde, weil es gesellschaftlich mit Mehrheit gewollt wird – ein Erfolg zuletzt der globalen Kampagnen um die großen Fabrikkatastrophen der Jahre 2021/2013. Soll das zum Tragen kommen, sind jetzt zwei Sachen durchzukämpfen. Die erste erklärt sich aus der geschilderten Situation in Südasien, die im Grunde den ganzen globalen Süden trifft: kapitalistische Globalisierung im Anspruch unters Menschenrecht zu stellen, heißt heute, einen als partikularen (Arbeits-)Kampf historisch verlorenen Kampf perspektivisch zu einem universellen Kampf um Form und Sache selbst der Globalisierung zu machen. Seine Bewährung findet er mit seinen Subjekten, an deren Zustimmung er appelliert. Denn ein Menschenrechtskampf gegen kapitalistische Ausbeutung wäre nicht nur die Sache derer, die ihr unmittelbar unterliegen, es wäre mehr als ‚nur‘ ein Klassenkampf und schon gar kein Arbeitskampf mehr. Er wäre nicht nur in den Fabriken, sondern entlang der ganzen Herstellungs- und Lieferketten zu führen, von denen, die da beliefert werden, und denen, die das Ausgelieferte herstellen. Wer ihm beitritt, folgt keinem unmittelbaren ‚Klasseninteresse‘, sondern gibt eine politische Antwort auf die Frage, in welcher Welt wir alle morgen eigentlich leben wollen.“
https://express-afp.info/der-express-2-2021-ist-erschienen
Martin Ling: „Kein scharfes Schwert“, ND Online vom 12. Februar 2021:
„Mit dem Lieferkettengesetz werden erstmals überhaupt deutsche Unternehmen in Verantwortung genommen für das, was ihre Zulieferer im Ausland veranstalten. Bisher konnte es ihnen egal sein, wenn bei ihren Vertragspartnern soziale und ökologische Standards mit Füßen getreten wurden. Nun sollen vorerst nur die großen Unternehmen per Gesetz verpflichtet werden, auch bei ihren ausländischen Zulieferern auf die Einhaltung von menschenrechtlichen, sozialen und Umweltstandards zu achten. Das ist ein Fortschritt. Denn an freiwillige Selbstverpflichtungen haben sich die wenigsten Unternehmen gehalten – der Profit geht vor! Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat für die Entschärfung hart gekämpft: Die Bundesregierung verzichtet auf eine zivilrechtliche Haftung. So haben direkt Geschädigte keine Möglichkeit, Firmen hierzulande gerichtlich zu belangen. Das scharfe Schwert wurde weggesteckt.“
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1148259.lieferkettengesetz-kein-scharfes-schwert.html?sstr=lieferkettengesetz
„Fauler Kompromiss bei Lieferkettengesetz“, junge Welt Online vom 13. Februar 2021:
„Beifall für die Novelle kam von der Kapitalseite: Auf den ersten Blick sei die regierungsinterne Einigung zum Lieferkettengesetz ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zu den bisherigen, weltfremden Vorstellungen aus den Arbeits- und Entwicklungsministerien, so Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander in einer Mitteilung am Freitag. Die Partei Die Linke dagegen äußerte sich kritisch. Der Kompromiss sei eine Absage an den wirksamen Schutz der Menschenrechte. Ohne eine Unternehmenshaftung sei das Gesetz ein zahnloser Tiger, erklärte Michel Brandt, Obmann für die Linksfraktion im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, in einem Pressestatement gleichentags. ‚Immer wieder sehen deutsche Unternehmen bei Menschenrechtsverstößen weg und profitieren sogar davon. Sie müssen deshalb von Betroffenen zur Rechenschaft gezogen werden können, sonst bleibt alles wie es ist‘, sagte Brandt weiter. Franziska Humbert von der Entwicklungsorganisation Oxfam bezeichnete den Kompromiss als ‚Lightversion‘ eines wirksamen Gesetzes. Sie beklagte: ‚Dass deutsche Wirtschaftsverbände außerdem durchgesetzt haben, dass die Regelungen nur für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelten, bedeutet, dass die Mehrzahl der deutschen Unternehmen einfach weitermachen kann wie bisher.‘“
https://www.jungewelt.de/artikel/396361.unternehmerlobby-fauler-kompromiss-bei-lieferkettengesetz.html?sstr=Lieferkettengesetz
Hannes Koch: „Menschenrechte achten“, Taz Online vom 12. Februar 2021:
„Laut Heil müssen hiesige Unternehmen künftig ihre Lieferkette untersuchen und dies in Risikoberichten dokumentieren. Dabei gibt es jedoch Abstufungen. Die höchsten Standards gelten im eigenen Betrieb. Dann folgen etwas abgeschwächt die direkten Zulieferer. Um die Zustände bei deren Vorlieferanten müssen sich die hiesigen Firmen nur kümmern, wenn es einen Anlass zur Sorge gibt. (…) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) in Eschborn bei Frankfurt/Main, eine nachgeordnete Behörde des Wirtschaftsministeriums, wird die Dokumente der Firmen überprüfen und bei Bedarf Kontrollen im In- und Ausland durchführen. Halten Unternehmen die Regeln nicht ein, drohen ihnen ‚Zwangs- und Bußgelder‘, so Müller. Bei deutlichen Verstößen können Betriebe zur Strafe sogar für drei Jahre von öffentlichen Ausschreibungen in Deutschland ausgeschlossen werden.
Während Müller und Heil den Arbeiter:innen der Zulieferfabriken ursprünglich den Gang zu deutschen Gerichten erleichtern wollten, hat Altmaier das verhindert. Eine verschärfte zivilrechtliche Haftung gibt es im Gesetzentwurf nicht. Allerdings sollen Gewerkschaften, Bürgerrechts- und Entwicklungsorganisationen künftig die Möglichkeit bekommen, im Namen von ausländischen Geschädigten vor hiesigen Gerichten zu klagen. Diese Drohung dürfte Firmen anspornen, das Gesetz einzuhalten.“
https://taz.de/Regierung-vereinbart-Lieferkettengesetz/!5748604/
„Koalition einigt sich auf Lieferkettengesetz“, Der Spiegel Online vom 12. Februar 2021:
„Unternehmen müssen künftig bei Verstößen gegen die Sorgfaltspflicht nur mit einem Bußgeld rechnen. Sie sollen dann auch bis zu drei Jahre von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden. Es soll jedoch keine zivilrechtliche Haftung der Unternehmen geben – das hatte Altmaier abgelehnt. Wirtschaftsverbände hatten argumentiert, eine zivilrechtliche Haftung von Unternehmen für unabhängige Geschäftspartner im Ausland, die dort eigenen gesetzlichen Regelungen unterliegen, sei realitätsfern. In diesem Falle drohe, dass sich deutsche Firmen wegen zu hoher Risiken aus vielen Ländern der Welt zurückziehen.“
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/koalition-einigt-sich-auf-lieferkettengesetz-a-4312009c-0875-4d74-90ca-f26a51711916
„Bundesregierung einigt sich auf abgeschwächtes Lieferkettengesetz“, Pressestatement der „Initiative Lieferkettengesetz“ vom 12. Februar 2021:
„Ein wirkungsvolleres Gesetz wäre möglich gewesen. Doch offenbar sind der CDU ihre guten Beziehungen zu den Wirtschaftsverbänden wichtiger als der effektive Schutz von Menschenrechten und Umwelt. Nur so ist zu erklären, dass das Gesetz zunächst nur für so wenige Unternehmen gilt. Durch die fehlende zivilrechtliche Haftung wird Opfern von schweren Menschenrechtsverletzungen ein verbesserter Rechtsschutz vor deutschen Gerichten verwehrt. Und auch die Pflicht zur Einhaltung von Umweltstandards berücksichtigt das Gesetz nur marginal – hier gibt es dringenden Nachbesserungsbedarf.
Umso wichtiger ist es, dass in Zukunft eine Behörde prüfen wird, ob sich Unternehmen an ihre Sorgfaltspflichten halten. Verstößt ein Unternehmen gegen seine Pflichten, kann die Behörde Bußgelder verhängen und das Unternehmen von öffentlichen Aufträgen ausschließen. Das ist ein großer Fortschritt zu den bisherigen freiwilligen Ansätzen.
Die Bundestagsabgeordneten fordern wir nun dazu auf, sicherzustellen, dass die Sorgfaltspflichten von Unternehmen den UN-Leitprinzipien entsprechen. Ein Lieferkettengesetz muss auch Umweltstandards abdecken und eine zivilrechtliche Haftungsregelung enthalten, um die Schadensersatzansprüche von Betroffenen zu stärken.“
https://lieferkettengesetz.de/presse/
Lena Hollender (Greenpeace), „Ein Lieferkettengesetzchen“, 16. Februar 2021:
„In die Diskussion um ein deutsches Lieferkettengesetz ist Bewegung gekommen. (…) Die Politik feiert sich für den Erfolg. Dabei beinhaltet der Kompromiss keine zivilrechtliche Haftungsregelung, wenn Unternehmen gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen. Auch wird nicht die gesamte Lieferkette abgedeckt. (…)
Sowohl Verletzungen von Menschenrechten und Arbeitsstandards, als auch Umweltschäden geschehen häufig in Produktionsländern außerhalb der EU. Damit finden sie überwiegend am Anfang von globalen Lieferketten statt. (…) ‚Ein Lieferkettengesetz ist deshalb nur dann wirksam, wenn es verbindliche Haftungsregeln für die ganze Länge der Wertschöpfungskette beinhaltet‘, sagt Viola Wohlgemuth, Expertin für Konsum und Ressourcenschutz bei Greenpeace. ‚Es muss schlicht gewährleisten: Wer Umweltschutz und Menschenrechte aus Profitgier missachtet, wird künftig zur Verantwortung gezogen, egal wo auf der Welt er sie begeht‘, mahnt sie. (…) Nun soll das Gesetz noch vor der Bundestagswahl in diesem Jahr verabschiedet werden. Nach einem monatelangen Streit hatte bis zuletzt vor allem der Wirtschaftsminister eine Einigung blockiert. Jetzt zetert der wirtschaftspolitische Flügel der CDU/CSU gegen das geplante Gesetz. (…)
Damit sich die deutsche Wirtschaft auf die Vorgaben einstellen kann, soll das Gesetz ab 2023 inkrafttreten. Betroffen sind zunächst allerdings nur Firmen mit mehr als 3000 Mitarbeitenden, erst ein Jahr später soll das Gesetz dann auch für Firmen gelten, für die mehr als 1000 Menschen arbeiten. Auch diese ‚Verschärfung‘ klammert jedoch den gesamten Mittelstand, die größte Gruppe von Firmen in Deutschland, aus.“
https://www.greenpeace.de/themen/umwelt-gesellschaft/wirtschaft/ein-lieferkettengesetzchen
Nicole Bastian/Dana Heide: „Joe Kaeser fordert gemeinsame europäische Antwort auf Chinas Wirtschaftsstrategie“, Interview mit dem ehemaligen Siemens-Chef Joe Kaeser, Handelsblatt Online vom 26. Februar 2021
„Politische Aufgaben sollten der Politik überlassen werden. Da gehören sie hin. Wir als Unternehmen haben aber die Verpflichtung, dass in unserem Wirkungsbereich Menschenrechtsstandards, wie etwa das Verbot von Zwangs- oder Kinderarbeit, eingehalten werden. Ich begrüße daher auch ausdrücklich das Lieferkettengesetz. Ich finde es richtig, dass ein Unternehmen seine Lieferanten überprüft, das kann man von ihm verlangen – übrigens auch von kleineren. Das muss aber praktikabel bleiben und kann sich nur auf die unmittelbaren Zulieferer, mit denen wir als Kunde im direkten Kontakt stehen, beschränken. Bürokratie haben wir schon genug.“ (Joe Kaeser)
https://www.handelsblatt.com/politik/international/interview-joe-kaeser-fordert-gemeinsame-europaeische-antwort-auf-chinas-wirtschaftsstrategie-/26952212.html
Frank Specht: „Das Lieferkettengesetz wird die Erwartungen nicht erfüllen“, Handelsblatt Online vom 14. Februar 2021:
„Es sei ein Gesetz ‚mit Zähnen‘ geworden, lobt Arbeitsminister Heil. Man bringe die Menschenrechte voran, ohne die Wirtschaft zu sehr mit Bürokratie zu belasten, lobt sich Wirtschaftsminister Altmaier selbst. Beide irren. An der Situation der Teepflückerin im indischen Assam, die Entwicklungsminister Müller als Beispiel nannte, an den Zuständen in Kobaltminen im Kongo oder Textilfabriken in Bangladesch wird das Gesetz wenig ändern. Zu lang sind die Lieferketten bis hin zum Rohstoffproduzenten, zu undurchsichtig die Verästelungen der globalen Wirtschaft, als dass deutsche Unternehmen sie wirklich bis ins letzte Glied durchschauen könnten. Und die Klage des afrikanischen Kobaltschürfers vor deutschen Gerichten wird nur unwesentlich leichter dadurch, dass ihn jetzt NGOs dabei unterstützen dürfen. Statt Zähnen hat das Gesetz allenfalls Zähnchen. Und die Bürokratie? Die vom Gesetz betroffenen Konzerne werden mit neuen Berichtspflichten belegt, obwohl sie ihre direkten Zulieferer ohnehin im Blick haben. Schon weil Investoren Wert auf nachhaltige Investments legen und die Firmen es sich gar nicht leisten können, in den Ruch von Menschenrechtsverletzungen zu kommen. Trotzdem müssen sie ab 2023 viel Papier mit Texten bedrucken, die am Ende niemand liest.
Die Grundproblematik des Gesetzes bleibt: Wie sollen Unternehmen hinbekommen, was Staaten mit Menschenrechtspolitik, Sanktionen und Importregularien nicht schaffen? Während die Politik den Rückzug von Firmen aus kritischen Regionen wünscht, stützt sie mit Entwicklungshilfe korrupte Regime, die bei Menschenrechtsverletzungen beide Augen zudrücken oder sie selbst zu verantworten haben.“
https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-das-lieferkettengesetz-wird-die-erwartungen-nicht-erfuellen/26913630.html
Manfred Schäfers: „Eine Kette für den Handel“, FAZ Online vom 12, Februar 2021:
„Der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig. Die deutsche Wirtschaft leidet enorm unter der Pandemie. Auch wenn die Industrie noch einigermaßen gut läuft, heißt das nicht, dass keine Gefahren existieren. In dieser Situation ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen, bleibt riskant. Vom Jahr 2023 an sollen Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern in Deutschland in die neue Pflicht genommen werden, ein Jahr später sinkt die Schwelle schon auf 1000.
Anzuerkennen (ist), dass die direkten Folgen für die Unternehmen im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen von Müller und Heil etwas begrenzt wurden. Der Entwurf sieht keine neue privatrechtliche Haftung vor. Die neuen Pflichten betreffen nur Menschenrechte, nicht Umweltstandards. Konkrete Verantwortung erhalten die Unternehmen allein für ihre direkten Zulieferer, bei den mittelbaren müssen sie aber aktiv werden, wenn sie von Missständen erfahren.
Aus Sicht der Wirtschaft hätte es schlimmer kommen können. Aber was nicht ist, kann noch werden. Der Ausbau der Bürokratie ist schon sicher. Unklar ist, ob die neuen Normen den Menschen im Süden helfen. Die Armut in der Welt lässt sich nicht mit einem deutschen Gesetz abschaffen. Wer Entwicklung will, braucht Handel. Ob da das neue Gesetz hilft? Zweifel sind mehr als berechtigt.“
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/sorgfaltspflichtengesetz-armut-abschaffen-in-corona-pandemie-17194695.html
Daniel Goffart: „Firmen haften nur für die erste Reihe der Lieferanten“, WirtschaftsWoche Online vom 15. Februar 2021:
„Wirtschaftsminister Altmaier hatte hingegen immer vor neuen Belastungen für die Unternehmen gewarnt, allerdings könne er jetzt mit dem Kompromiss leben, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Eine zivile Haftung für die Wirtschaft gebe es nicht. Damit hat Altmaier einen aus seiner Sicht wichtigen Punkt umgesetzt, denn die Wirtschaftsverbände hatten immer wieder vor Wettbewerbsnachteilen auf globalen Märkten gewarnt. (…)
Dennoch regte sich Kritik in den Reihen der Unionsfraktion im Bundestag. Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU/CSU, Joachim Pfeiffer, sagte der WirtschaftsWoche, dass er ‚den Sinn des Vorhabens nicht erkennen‘ könne. ‚Deutsche Unternehmen achten wie kaum andere in der Welt auf die Einhaltung von Arbeitsschutz und menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. Das ist weltweit bekannt und anerkannt. Sie sind deshalb in aller Welt gern gesehen und hochwillkommen‘, so der Wirtschaftsexperte. (…) Statt zu entlasten, schaffen wir neue Belastungen für die Unternehmen, die ganz sicher Zeit brauchen werden, sich von der aktuellen Coronakrise zu erholen‘, kritisierte Pfeiffer. (…)
Der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Textil- und Modeindustrie, Uwe Mazura, kündigte eine ‚kritische Begleitung‘ der Beratungen und Gesetzesarbeit an. ‚Bemerkenswert ist, wie viele Kapazitäten die Bundesregierung für ein neues Gesetz hat, während unsere Unternehmen seit Monaten auf Coronahilfe warten und ihre werthaltige Mode in den geschlossenen Geschäften nicht verkauft werden darf‘.
Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander sagte, mit der Einigung sei ‚die Grenze des Machbaren für die Unternehmen absolut erreicht, vielleicht teilweise auch etwas überschritten‘. Allerdings habe es Wirtschaftsminister Altmaier geschafft, ‚weltfremde Vorstellungen‘ aus den anderen Ressorts weg zu verhandeln. Wichtig sei, dass Haftungsregeln verhindert wurden und dass die betroffenen Unternehmen nur für das erste Glied ihrer Lieferkette direkt verantwortlich seien. (…)
Skepsis und Kritik äußert auch die Gesellschafterin des Klebstoffspezialisten Delo, Sabine Herold: ‚Ich halte es weiter für grundfalsch, Unternehmen die Aufgabe aufzubürden, bei der die Politik gescheitert ist – Menschenrechte in Drittstaaten durchzusetzen‘, sagte sie der WirtschaftsWoche. Natürlich gäbe es Missstände in einigen Bereichen. Aber deshalb alle Unternehmen mit einer hochgradig bürokratischen Regelung zu überziehen anstatt ausschließlich problematische Felder zu regulieren, sei ‚weit über das Ziel geschossen und schadet unnötig am Ende allen Verbrauchern durch Mehrkosten ohne Zugewinn‘.“
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/lieferkettengesetz-firmen-haften-nur-fuer-die-erste-reihe-der-lieferanten/26910770.html