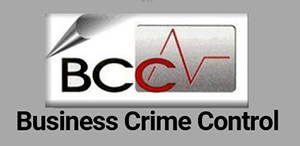Aktuell steht die sogenannte Clan-Kriminalität (CK) als Teil der organisierten Kriminalität (OK) verstärkt im Fokus von Polizei und medialer Öffentlichkeit. [1] Neben den um ein Vielfaches größeren Flächenländern Bayern und Nordrhein-Westfalen gilt Berlin als eine Hochburg der OK. Unabhängig von ihrer parteipolitischen Provenienz verfolgen die zuständigen Innenminister und -senatoren in den Zentren der OK eine „Null-Toleranz-Politik“ vornehmlich gegen arabische Gruppierungen. Vor allem die Boulevardpresse feiert in weiten Teilen das konsequente Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden gegen die „Clans“. Zugleich wehren sich Kritiker*innen gegen die stigmatisierende Pauschalisierung arabischstämmiger Menschen als kriminelle Bedrohung und die von ihnen als hysterisch erlebte Berichterstattung. „In den Medien wird unser Stadtteil nur in Blaulicht gebadet gezeigt. Bilder von Polizist*innen, die junge Männer abführen, begleitet von bedrohlicher Musik und alarmistischen Überschriften zu Kriminalität und Gewalt. Die Debatte um die sogenannte Clan-Kriminalität ist gezeichnet durch Vorurteile und malt ein verzerrtes Bild von Neukölln als Gefahrenzone“, heißt es beispielsweise in einem Aufruf zu einer Kundgebung, die anlässlich einer von der Fraktion der AfD initiierten Debatte über polizeiliche Razzien Ende Februar 2020 in der Bezirksverordnetenversammlung des Berliner Bezirks stattfand.
Neben den zuletzt intensivierten öffentlichen und politischen Auseinandersetzungen soll im Folgenden auch der polizeiliche und (populär-)wissenschaftliche Diskurs zur Rolle und Bedeutung der OK bzw. krimineller „Clans“ beleuchtet werden
OK, Clan-Kriminalität und Mafia – eine Begriffsklärung
Sogenannte polizeiliche Lagebilder fassen mittels Statistiken und exemplarischer Falldarstellungen die zu einem bestimmten Zeitpunkt aktuellen Erkenntnisse und Entwicklungen in einzelnen Themenfeldern zusammen. Die offizielle Definition organisierter Kriminalität, die den Erhebungen für die Lagebilder im Bund und in den Ländern zugrunde gelegt wird, wurde im Mai 1990 von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Justiz und Polizei vorgelegt. Organisierte Kriminalität ist danach „die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder c) unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zusammenwirken.“
Nach Meinung vieler Rechtswissenschaftler*innen und Praktiker*innen zeichnet sich die Formulierung durch eine mehrfache Unschärfe aus, die sie für eine exakte Abgrenzung organisierter gegenüber nicht organisierter Kriminalität wertlos macht. Denn zur Bildung einer Gruppe organisierter Krimineller reicht bereits das arbeitsteilige Zusammenwirken von lediglich drei Personen aus. Die durch das Wort „oder“ markierten alternativen Definitionskriterien eröffnen zudem eine Vielzahl von Konstellationen, in denen OK erkennbar sein soll. Bei einer Anhörung im Bundestag im Oktober 1993 spottete denn auch der damalige Präsident des Bundeskriminalamts, Hans-Ludwig Zachert, über diese Definition, die „selbst Eingeweihten nur in glücklichen Stunden verständlich“ sei. [2] Auch die Kriminolog*innen Klaus von Lampe und Susanne Knickmeier sprechen dem Terminus einen relevanten juristischen und polizeilichen Bedeutungsgehalt ab: „Die Definition dient hauptsächlich der Klärung von Zuständigkeiten innerhalb der Strafverfolgungsbehörden sowie der Erstellung von Lagebildern. Demgegenüber ist ihre Bedeutung für die konkrete Ermittlungsarbeit, aber auch für die Gesetzgebung und Rechtsprechung eher gering.“ [3] Insofern sei es problematisch, von „der“ OK zu sprechen oder OK überhaupt als eine analytische Kategorie zu verstehen.
Der Verzicht auf eine begriffliche Eingrenzung eröffnet den Strafverfolgungsbehörden vielmehr die Möglichkeit, je nach Interessenlage Delikte willkürlich als OK zu kategorisieren oder darauf zu verzichten. Damit wird zugleich einer politischen Instrumentalisierung des Phänomens Vorschub geleistet. Von Lampe empfiehlt deshalb, den Begriff „als analytische Kategorie zu verwerfen und die als ‚organisierte Kriminalität‘ etikettierten Erscheinungen jeweils gesondert zu betrachten, ohne sich durch die Annahme eines übergeordneten Zusammenhangs, der durch den OK-Begriff suggeriert wird, den Blick auf die Dinge verstellen zu lassen“. [4]
Ebenso wenig existiert bislang eine bundesweit verbindliche Definition des Begriffs CK. Um diese aber ansatzweise greifbar zu machen, verständigten sich die Bundes- und Landesbehörden auf einzelne Zuordnungskriterien. Laut Bundeslagebericht Organisierte Kriminalität 2018 ist CK „die Begehung von Straftaten durch Angehörige ethnisch abgeschotteter Subkulturen. Sie ist bestimmt von verwandtschaftlichen Beziehungen, (…) und einem hohen Maß an Abschottung der Täter (…) Dies geht einher mit einer eigenen Werteordnung und der grundsätzlichen Ablehnung der deutschen Rechtsordnung“. CK kann dabei einen oder mehrere der folgenden Indikatoren aufweisen: „Eine starke Ausrichtung auf die zumeist patriarchalisch-hierarchisch geprägte Familienstruktur, eine mangelnde Integrationsbereitschaft mit Aspekten einer räumlichen Konzentration, das Provozieren von Eskalationen auch bei nichtigen Anlässen oder geringfügigen Rechtsverstößen, die Ausnutzung gruppenimmanenter Mobilisierungs- und Bedrohungspotentiale“.
Im Lagebild Organisierte Kriminalität Berlin 2018 heißt es ergänzend:
„Der Phänomenbereich ist von einer in weiten Teilen der arabischstämmigen Community bestehenden Parallelgesellschaft geprägt und geht einher mit einer mangelnden Akzeptanz oder sogar Ablehnung des in Deutschland vorherrschenden Werte- und Normensystems. Vielfach treten die kriminellen Clanmitglieder mit Ordnungsverstößen und Straftaten im Bereich der Allgemeinkriminalität in Erscheinung, aber auch im Bereich der Organisierten Kriminalität.“
Kurz gesagt: BKA und LKA Berlin legen den Fokus auf eine bestimmte „Subkultur“, der arabischen, und der von ihr etablierten „Parallelordnung“, getragen von „Clans“ oder „Großfamilien“ als feste, geschlossene Gruppe. Bei der Vorstellung des neuen Lagebilds Organisierte Kriminalität des LKA für Berlin im Dezember 2019 führte Innensenator Andreas Geisel (SPD) diesen Punkt weiter aus. Nicht der Großteil der arabischen Community sei gemeint, sondern nur die Clan-Familien. Eigentlich gehörten nur Teile der „Clans“ zur OK. In diesen Großfamilien bis zu 1.000 Personen seien nicht alle kriminell, aber es gebe eine hohe Zahl von auffälligen Personen. Einige davon seien im Bereich OK unterwegs, andere würden „in der zweiten Reihe parken“ und trügen Rolex. Das sei nicht kriminell, höhle aber den Rechtsstaat aus. Barbara Slowik, Berlins Polizeipräsidentin, ergänzte, CK habe auch damit zu tun, „dass wir gegen ein Dominanzverhalten vorgehen wollen“. Gemeint seien neben dem „Parken in der zweiten Reihe“ auch Hochzeitskorsos. Das sei zwar nicht kriminell, aber da würde es „anfangen“. Auch die Großrazzien in Neuköllner Shisha-Bars und Geschäften seien keine Maßnahmen gegen OK, sondern gegen nicht akzeptable „Regelverstöße“ wie Verletzung des Immissionsschutzes oder Tabakschmuggel. [5]
„Dominanzverhalten“ und „Regelverstöße“: Die Polizeipräsidentin und der Innensenator betonen zwar unisono, dass es wichtig sei, zwischen CK und OK zu unterscheiden. Offensichtlich steht nicht der wirtschaftliche Schaden, sondern das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung im Mittelpunkt des polizeilichen und politischen Vorgehens. Der Lagebericht aus Berlin bestätigt entsprechend, dass die kriminellen Clanangehörigen mit Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Erscheinung treten, „die zu einem überwiegenden Teil auf den Bereich der Allgemein- und Massenkriminalität entfallen“. Aber auch Aktivitäten unterhalb der Schwelle zur Kriminalität stellen nach Auffassung der Polizeichefin und des Senators einen Angriff auf den Rechtsstaat dar.
Italienische Familien, die der klassischen Mafia zugerechnet werden, spielen dagegen in Berlin laut Lagebericht kaum eine Rolle. Denn anders als die libanesischen und andere „Clans“, als deren Markenzeichen die lautstarke Protzerei mit aufgemotzten Luxuskarossen und anderem Machogehabe gilt, bewegt sich die Mafia weitgehend außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung. „Kritiker sehen darin die bewusst erklärte Stille eines kriminellen Geschäfts, das vor allem wegen dieser Ruhe prosperiert. So sei es durchaus politisch gewollt, dass die Mafia in Deutschland strukturell unterschätzt wird, damit deren Geld auch weiterhin in den deutschen Wirtschaftskreiskauf fließt.“ [6] Das in der offiziellen OK-Definition zuletzt genannte Kriterium, also die Einflussnahme auf staatliche Institutionen oder die Medien, fehlt bei dem Phänomen der CK. Es ist hingegen charakteristisch für die Mafia in Italien, die bis in die höchsten politischen Kreise hinein vernetzt ist.
Während die „Clans“ nach Darstellung von Polizei und Medien die Rechtsordnung und den angeblich von ihnen als schwächlich erlebten Rechtsstaat verachten, zielt die Mafia nicht primär auf eine Schwächung oder gar Vernichtung der herrschenden Staatsordnung. Mafiagruppierungen verstehen sich eher als Wirtschaftsunternehmen, welche die politischen Verhältnisse indirekt zu beeinflussen suchen, um die Rahmenbedingungen für das eigene (kriminelle) wirtschaftliche Handeln positiv zu gestalten. „In diesem Sinne“, schreibt Martin Ludwig Hofmann, „dürfte sich die Mehrzahl der ‚Ehrenmänner‘ durchaus als Bürger und Mitglieder des Staates empfinden, dem sie so lange Loyalität entgegenbringen, so lange die staatlichen Interessen nicht mit den eigenen kollidieren. Die Mafia-Clans positionieren sich damit selbst ‚innerhalb‘ des staatlichen Gefüges befindlich und knüpfen zur Festigung dieses ‚Innerhalb‘ den Kontakt zu lokalen (und darüber hinaus) Vertretern der Politik und der staatlichen Administration. Dieser Kontakt wiederum scheint oft von beiden Seiten gesucht zu werden, da er nicht nur den Vertretern der Mafia einen Nutzen verspricht“. [7] Auch Sandro Mattioli vom Verein Mafianeindanke, nach eigenen Angaben die wichtigste Antimafia-Organisation hierzulande, bestätigt, dass die italienische Mafia in Deutschland „möglichst unter dem Radar“ agiert und sich im legalen Wirtschaftsleben etabliert hat, etwa im Baugewerbe oder in der Gastronomie. [8]
Die durchlässige Grenze zwischen Mafia-Organisationen und staatlichen Institutionen sowie dem regulären Wirtschaftsleben ist sicherlich ein entscheidender Grund dafür, dass der Staat im Gegensatz zum entschlossenen Durchgreifen gegen vornehmlich arabischstämmige „Clans“ kaum Interesse zeigt, die italienische Mafia effektiv zu verfolgen. So moniert Mafianeindanke, dass der Berliner Senat kein Personal bereitstellt, um in der Hauptstadt gegen die ‘Ndrangheta als eine der global bedeutendsten kriminellen Organisationen vorzugehen. Auch kritisiert der Verein die Ergebnisse des aktuellen Bundeslageberichts zur OK. Laut BKA wurde 2018 gegen 124 Mitglieder der ‘Ndrangheta in Deutschland ermittelt, während nach Informationen der Bundesregierung von mindestens 800 bis 1.000 Mitglieder der kalabrischen Mafia auszugehen ist. Der weitaus größte Teil der Mafiosi in Deutschland bleibt danach also unbehelligt. [9]
Defizitäre Forschung
Im Februar 2018 erschien eine wissenschaftliche Einschätzung der OK-Forschungslandschaft in Deutschland. Das Ergebnis war niederschmetternd: Die Forscher*innen stellten eine ausgeprägte Diskrepanz zwischen der relativ großen Zahl „einschlägiger“ Veröffentlichungen und dem vergleichsweise geringen Umfang empirischer Forschung fest. Die bisherige Forschung sei „insulär“, die wenigen Untersuchungen bauten also nicht aufeinander auf und könnten nur begrenzt den Erkenntnisstand erweitern. [11] Ein wesentliches Forschungsproblem besteht offensichtlich in dem schwierigen Datenzugang der Kriminolog*innen, denn diese seien nahezu ausschließlich auf Ermittlungsergebnisse von Polizei- und Justizbehörden angewiesen. Die exekutiven Organe, die sich praktisch mit der OK auseinandersetzen, bieten jedoch nicht die für die wissenschaftliche Reflektion nötige Distanz zum Untersuchungsobjekt. Zudem stellen Polizei und Staatsanwaltschaften ihre zum Teil geheimen Ermittlungsergebnisse nur ungern Externen zur Verfügung. Die „Beobachtungsferne“ der Kriminologie führt deshalb naturgemäß zu unbefriedigenden empirischen Forschungsergebnissen.
Hinzu kommt, dass die wissenschaftliche Bearbeitung des Themas in erster Linie im Bereich der Rechtswissenschaften erfolgt, die notwendige interdisziplinäre Kooperation von Kriminologie, Soziologie, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Rechtswissenschaft aber offensichtlich nur rudimentär stattfindet. Soziologische Leerstellen, wie die Frage nach der tatsächlichen Lebenswirklichkeit (krimineller) Milieus jenseits von Klischeevorstellungen über sogenannte Clans oder Großfamilien, werden deshalb durch sensationslüsterne TV-Reportagen oder reißerisch aufgemachte Presseartikel ausgefüllt, bei denen nicht selten die Tendenz zu einer Ethnisierung der Kriminalität auszumachen ist.
Daneben bewegen sich an der Schnittstelle von Forschung und polizeilicher Arbeit Fachorgane wie etwa die „Kriminalistik: Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und Praxis“, die ein wichtiges Forum für die polizeiliche Diskussion um OK darstellt. Im Editorial des Heftes 5/2019, dessen Schwerpunkt der CK gewidmet ist, beschwört der Chefredakteur „das immense Gefahrenpotential krimineller arabischer Clans“ und betont, dass es „allerhöchste Zeit“ wird, „konsequent gegen Clans unter Einsatz aller rechtlichen Möglichkeiten“ vorzugehen. [12] Auch Magazine wie dieses prägen den Diskurs um OK und CK neben populärwissenschaftlichen Monografien und vor allem der Boulevardpresse entscheidend mit.
Wie reagiert die Politik
Einen Eindruck von der herrschenden „Null-Toleranz-Politik“ zur Bekämpfung von OK und Clan-Kriminalität vermittelt das Vorgehen der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Innenminister Herbert Reul (CDU) betonte wiederholt in der Öffentlichkeit, dass der eingeschlagene Weg, regelmäßig Razzien durchzuführen, fortgesetzt und sogar intensiviert werden soll (so zum Beispiel am 23. Dezember 2019 im Radiosender WDR 5). Zur bisher größten Razzia Anfang 2019 rückten über 1.300 Beamte von Polizei sowie Zoll- und Ordnungsamt aus und durchsuchten Shisha-Bars, Wettbüros und Teestuben im Ruhrgebiet. Diese Großaktion bildete den Auftakt zu der mittlerweile viel zitierten „Strategie der 1.000 Nadelstiche“ gegen „Clans“ in Nordrhein-Westfalen. Passend dazu schlug im Herbst letzten Jahres eine von der NRW-Regierung eingesetzte Kommission vor, Polizei und Justiz mit deutlich mehr Befugnissen auszustatten. Sowohl die personellen wie die technischen und rechtlichen Möglichkeiten sollten erweitert und den beteiligten Behörden dadurch eine bessere Zusammenarbeit ermöglicht werden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Zoll- und Steuerfahndung, Ausländer- und Ordnungsämter).
In NRW gibt es laut LKA rund 100 kriminelle Familienclans, die sich lokal auf Essen, Duisburg, Gelsenkirchen und Recklinghausen konzentrieren. 36 Prozent der Tatverdächtigen, so heißt es weiter, seien deutsche Staatsbürger, die man nicht abschieben könne. „Gegen diejenigen Straftäter, die keine deutschen Staatsbürger sind, müssen die ausländerrechtlichen Maßnahmen allerdings konsequent ausgeschöpft werden“, forderte die Kommission. (General-Anzeiger Bonn vom 23. September 2020) Mitte 2020 wird deshalb in Essen im Rahmen der neuen Sicherheitskooperation Ruhr gegen CK eine behördenübergreifende Dienststelle ihre Arbeit aufnehmen, in der Maßnahmen gebündelt und koordiniert werden sollen. (vgl. General-Anzeiger Bonn vom 12. Januar 2020)
Begründet wird das rabiate Durchgreifen vor allem mit einem angeblich von der Öffentlichkeit als Bedrohung empfundenes Auftreten krimineller Familienclans. Denen werden laut aktuellem Lagebild zur OK in NRW Straftaten wie eine „vermeintliche Besetzung des öffentlichen Raums“, „häufig fehlenden Respekt gegenüber der Polizei und Rettungsdiensten“ sowie ein „aggressives Auftreten im Rahmen von sogenannten ‚Tumultlagen‘“ vorgeworfen. Zudem sei die Etablierung einer Parallelgesellschaft und -justiz (mit claninternen Streitschlichtern) feststellbar. Dieser Entwicklung soll durch einen „maximalen Kontroll- und Verfolgungsdruck“ entgegengewirkt werden.
Teile der Medien assistierten der staatlichen Repressionsstrategie, als Anfang Februar im Rahmen einer Razzia in Bottrop, Recklinghausen und anderen Orten insgesamt 20 Shisha-Bars und Cafés von Polizei und Zoll kontrolliert worden waren. „NRW: Nächster Schlag gegen Clans im Ruhrgebiet“ titelte etwa das Onlineportal DerWesten.de (Funke Mediengruppe). Das Missverhältnis von Großaufgebot an eingesetztem Personal und Ermittlungsergebnis wird am Ende des Artikels deutlich. Ein „verbotenes Messer“, unverzollter Shisha-Tabak und 39 Päckchen Tabletten, „die noch überprüft werden müssen“, wurden konfisziert.
Im Juli 2018 beschlagnahmte die Polizei in Berlin bei einer aus dem Libanon eingewanderten Familie vorläufig 77 Immobilien im Gesamtwert von rund 9,3 Millionen Euro. Dieses von Boulevard-Blättern als großen Schlag gegen die Clan-Kriminalität gefeierte polizeiliche Vorgehen entspricht der Erkenntnis, dass die Geldwäschebekämpfung die wichtigste, aber auch kontrollintensivste Komponente bei der Bekämpfung der OK darstellt. So richtig aber der Ansatzpunkt ist, mit Maßnahmen gegen die Sekundärkriminalität auch implizit die Primärkriminalität einzudämmen, so verhalten agiert der Staat letztlich auf diesem Feld. „Ein perfider Grund für die Nonchalance ist: Die deutsche Wirtschaft profitiert von dem schmutzigen Geld. Der Immobilienboom beschert dem Bausektor güldene Zeiten“, kommentierte die Süddeutsche Zeitung am 27. Oktober 2019.
Notare und Makler werden in Deutschland offenkundig nicht kontrolliert, obwohl sie bei Immobiliengeschäften eine entscheidende Rolle spielen. Michael Findeisen von der Bürgerbewegung Finanzwende etwa kritisiert die Situation in Berlin. „Da gab es früher einen Wirtschaftssenator von den Linken, jetzt ist es eine grüne Senatorin. Beide Parteien erklären sich ja immer als Schild und Speer im Kampf gegen Geldwäsche. Das ist halt ernüchternd. Da sitzen wirklich auf fünf Planstellen, da sind ein bis zwei immer krank, Leute rum, die zigtausende Gewerbeunternehmen, die unter das Geldwäschegesetz fallen, durch Prüfungen, Vor-Ort-Prüfungen prüfen sollen.“ [13] Aus politischen Gründen (auch illegale Investitionen sind Investitionen) und wegen der Stärke der Finanzlobby weicht der Staat offenbar davor zurück, die Vermögensabschöpfung aus kriminellen Geschäften in den Griff zu bekommen.
Schluss
Von „Clans“ verübte Kriminalität in Deutschland ist nichts Neues. Sie wird dabei schon seit vielen Jahren als „importierte Kriminalität“ vornehmlich libanesischer oder auch türkisch-kurdischer Herkunft thematisiert und skandalisiert. [14] Diese Variante der OK gilt insofern als Phänomen, das gleichsam von außen einen ansonsten „gesunden“ Rechtsstaat attackiert und gefährdet. OK und Wirtschaftskriminalität generell sind aber aus der gesellschaftlichen Mitte erwachsen. Unbestritten ist ein wichtiger Grund für kriminelles Verhalten von sogenannten Clans die bewusst unterbliebene Integrationspolitik gegenüber arabischen Menschen, die als Bürgerkriegsflüchtlinge seit Ende der 1970er Jahre in die Bundesrepublik einreisten. Mafia-Gruppen bleiben dagegen weitgehend unbehelligt, da sie zumeist unauffällig agieren und keine Provokation der Mehrheitsbevölkerung darstellen, somit auch nicht nach offizieller Lesart den „Rechtsfrieden“ bedrohen. Aber auch Deutsche ohne Migrationshintergrund sind wirtschaftskriminell – und verursachen damit das Gros des wirtschaftlichen Schadens. Sie verfügen jedoch über wirksamere Verschleierungsmöglichkeiten als diejenigen, die pauschal den „Clans“ zugerechnet werden und sichtbarer Teil des öffentlichen Lebens sind. Dieser Teil der Wirklichkeit wird weitgehend verdrängt, da sich viele Menschen von Delikten wie Subventionsbetrug oder Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zudem nicht direkt betroffen fühlen.
Deshalb sind übersteigerte Bedrohungsszenarien populärwissenschaftlicher Art ärgerlich. „Unterdessen ist längst der soziale Frieden in Gefahr. Deshalb ist es an der Zeit, sich ehrlich zu machen, gegenüber Kriminellen, die unseren Wohlstand – mittelbar aber auch unsere Freiheit – bedrohen“, warnt zum Beispiel der Journalist Olaf Sundermeyer in seinem Buch „Bandenland“ mit Blick auf die CK. [15] „Clans verhalten sich in ihrer deutschen Umgebung wie die Stämme in der Wüste: Alles, was außerhalb der Clans liegt, ist Feindeslands und frei zu erobern“, ergänzt der Migrationsforscher Ralph Ghadban. [16] Nicht OK und CK aber stellen eine fundamentale Bedrohung für die Gesellschaft dar, vielmehr das – „mafiöse“ – Zusammenspiel von kriminellen und gesellschaftlichen Eliten.
Eine besonders zynische Note erhält die alarmierende und effekthascherische Darstellung der CK schließlich vor dem Hintergrund der Morde an Menschen mit migrantischem Hintergrund. Anlässlich der Bekanntgabe seiner Kandidatur für den CDU-Vorsitz verknüpfte Friedrich Merz die Bekämpfung von Rechtsradikalismus mit einem härteren Vorgehen gegen „Clans“ in sogenannten Problemvierteln. Ganz im Sinne des Bundesinnenministers Horst Seehofer, der schon im Herbst 2018 vor dem Hintergrund der rassistischen Demonstrationen in Chemnitz die Migration als „Mutter aller Probleme“ bezeichnete.
Äußerungen wie diese trugen und tragen dazu bei, dass ein gesellschaftliches Klima entsteht, das Rechtsradikale zusätzlich motiviert, in die Offensive zu gehen. Seit 2010 wurden beispielsweise im Berliner Bezirk Neukölln immer wieder Wohnungen, Cafés und Autos beschädigt oder sogar angezündet. Auch erhielten Menschen, die sich gegen rechts engagieren, wiederholt Morddrohungen. Bewohner*innen des Kiezes sprechen seitdem von einem durch die Anschläge erzeugten „Klima der Angst“. Das Verhalten der Polizei trug dabei nicht zur Bildung eines Sicherheitsgefühls bei. Denn Anschlagswarnungen wurden nicht ernst genommen, manche glauben sogar an eine Verwicklung von Beamten in die Taten. Der Verfolgungsdruck muss also verstärkt werden – dort, wo gesellschaftlich integrierte Bürger*innen ihre wirtschaftskriminellen Geschäfte abwickeln und Nazi-Banden ganze Stadtbezirke in Angst versetzen.
Anmerkungen:
[1] Kritiker*innen lehnen die Begriffe „Clan“ oder „arabische Großfamilien“ aus guten Gründen als politische Kampfbegriffe ab.
[2] Zitiert nach Klaus von Lampe: „Geschichte und Bedeutung des Begriffs ‚organisierte Kriminalität‘“, in: Meropi Tzanetakis/Heino Stöver (Hrsg.), Drogen, Darknet und Organisierte Kriminalität. Herausforderungen für Politik, Justiz und Drogenhilfe, Baden-Baden, 2019, Seite 37
[3] Klaus von Lampe/Susanne Knickmeier: Organisierte Kriminalität: Die aktuelle Forschung in Deutschland, Berlin, Februar 2018, Seite 8
[4] von Lampe, 2019, Seite 38
[5] Vgl. Susanne Memarnia: „Organisierte Kriminalität in Berlin: Zweite-Reihe-Parken ist nicht OK“, taz vom 11. Dezember 2019
[6] Olaf Sundermeyer: Bandenland. Deutschland im Visier von organisierten Kriminellen, München, 2017, Seite 15
[7] Martin Ludwig Hofmann: Monopole der Gewalt. Mafiose Macht, staatliche Souveränität und die Wiederkehr normativer Theorie, Bielefeld, 2003, Seite 96f.
[8] Peter Podjavorsek: „Organisierte Kriminalität. Warum sich die Politik so schwertut“, Deutschlandfunk Kultur – Zeitfragen, 17. Februar 2020
[9] Vgl. Text vom 24. September 2019 unter https://mafianeindanke.de/category/mafia-de/ndrangheta-de/
[10] von Lampe/Knickmeier, Seite 73
[11] Vgl. Peter Podjavorsek
[12] Bernd Fuchs: „Editorial“, in: Kriminalistik 5/2019, Seite 274
[13] Vgl. Peter Podjavorsek
[14] Vgl. Markus Henninger: „‚Importierte Kriminalität‘ und deren Etablierung“, in: Kriminalistik 12/2019, S. 282-296; Nachdruck aus dem Jahr 2002)
[15] Olaf Sundermeyer, Seite 13
[16] Ralph Ghadban: Arabische Clans. Die unterschätzte Gefahr, Berlin, 2020, Seite 183
Joachim Maiworm
lebt und arbeitet in Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von BIG Business Crime. Eine kürzere Fassung seines Artikels ist in der BIG-Beilage zur Nr. 2/2020 der Zeitschrift Stichwort BAYER erschienen.
Anhang
Offizielle Kennzahlen der OK und der Clan-Kriminalität
(am Beispiel des Bundes und Berlins)