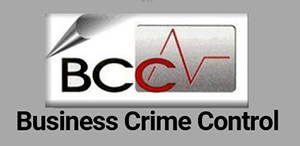Im April 2013 ereignete sich das bislang größte Unglück in der Bekleidungsindustrie: In Bangladesch stürzte das Gebäude der Textilfabrik Rana Plaza ein. Damals starben über 1.100 Menschen, 2.500 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Im Jahr zuvor kamen bei einem schweren Fabrikbrand der Firma Ali Enterprises im pakistanischen Karatschi 260 Menschen ums Leben.
Beide Fabriken produzierten für den Weltmarkt. Hauptkunde von Ali Enterprises war der deutsche Billiganbieter KiK, der damals nach eigenen Angaben für 70 Prozent der Aufträge verantwortlich war. Trotz des zweifellos vorhandenen Einflusses auf seine Zulieferer unterließ es der Discounter offensichtlich, auf einen ausreichenden Brand- und Arbeitsschutz hinzuwirken.
Als Reaktion auf diese Unglücke kam eine längst überfällige Diskussion über die Verantwortung von Unternehmen aus den nördlichen Industriestaaten für die desaströsen Arbeitsverhältnisse im globalen Süden international in Gang. Debattiert wurde über fehlenden Arbeitsschutz, Hungerlöhne, überlange Arbeitstage, Kinderarbeit, den Umgang mit gefährlichen Chemikalien und mangelhaften Brandschutz. Deutsche Textilfirmen lassen mittlerweile nahezu vollständig in Asien produzieren. Industrie und Politik versprechen seit geraumer Zeit, für bessere Bedingungen in den dortigen Zulieferfirmen zu sorgen.
Sechs bzw. sieben Jahre nach Rana Plaza und Ali Enterprises ist nach einhelliger Meinung kritischer Experten jedoch kaum etwas geschehen. Die Produktion läuft wie gehabt, Arbeitsausbeutung und Fabrikunfälle sind weiter an der Tagesordnung. KiK-Chef Patrick Zahn, der sein Unternehmen selbst als „echtes Schwergewicht“ im deutschen Einzelhandel bezeichnet, verteidigte die für die Arbeiter*innen verheerende Produktion in Ländern wie Bangladesch und Pakistan.
Im Nachhaltigkeitsbericht 2017 seines Unternehmens unterstrich Zahn klipp und klar die „oberste Priorität, das Unternehmen profitabel und auf Wachstumskurs zu halten. Denn nur, wenn der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens langfristig gesichert ist, kann nachhaltige Entwicklung gewährleistet werden.“ An anderer Stelle erklärte er, es sei keine Option, sich aus diesen Ländern zurückzuziehen. Damit wäre den Menschen dort überhaupt nicht geholfen (vgl. SPIEGEL Online vom 29. November 2018).
Intransparente Produktionsstruktur
Umgekehrt wird wohl eher ein Schuh draus: Die Profite auch der deutschen Textilkonzerne werden durch die miserablen Arbeitsbedingungen in den verzweigten Lieferketten mit rechtlich selbständigen Subunternehmen überhaupt erst ermöglicht. Die Komplexität des Systems bietet den Auftraggebern zugleich eine gute Ausrede dafür, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Darauf verweist Thomas Seibert, bei medico international zuständig für Südasien und Referent für Menschenrechte. In einem Radiogespräch stellte er jüngst klar, die Undurchschaubarkeit der Produktionsstruktur bilde letztlich die Voraussetzung für die Gewinnerzielung der Unternehmen in den Industriestaaten (vgl. SWR2 Forum vom 9. September 2019).
Je weiter unten Betriebe in der Lieferkette der globalen Produktions- und Vertriebsnetze angesiedelt sind, desto ungeschützter sind die Arbeitsbedingungen bei ihnen. Aus der Debatte verdrängt wird, so Seibert, dass dieses System gewollt ist, weil nur auf diesem Wege die ungeheuren Profitmargen realisiert werden können. Die Produktion von Bekleidung wurde schließlich aus Gründen der Kostensenkung in andere Länder verlagert, zuletzt nach Südasien, wo sie am billigsten ist. Strikte Preisvorgaben und eng gesetzte Liefertermine sorgen dabei für einen verschärften Arbeitsdruck auf Kosten der Beschäftigten.
Die Hauptbetroffenen der Standortverlagerungen und des Preiskampfs in der Textilbranche sind darum nicht die Menschen hierzulande, sondern die Näher*innen vornehmlich in Bangladesch und Pakistan. Zunächst sorgte der Aufstieg der westlichen Wirtschaftsmächte für einen rapiden Verfall der traditionellen Wirtschaftsstrukturen des globalen Südens. Zwar schafft die Verlegung von Produktionsstätten bzw. die Vergabe von Aufträgen an dort ansässige Subunternehmen dann in diesen Regionen dringend benötigte Arbeitsplätze. Zugleich zeigen die Fabrikunfälle aber auf drastische Weise, wie unmenschlich die Arbeitsbedingungen entlang der globalen Produktionsketten sind.
Die Externalisierung der sozialen und ökologischen Kosten durch deutsche Textilkonzerne stellt deshalb grundsätzlich die Frage nach ihrer moralischen und rechtlichen Verantwortung. Über Jahre war beispielsweise KiK nach der vermeidbaren Katastrophe von Ali Enterprises einer scharfen öffentlichen Kritik ausgesetzt – juristisch aber nicht belangbar.
Betroffene von Menschenrechtsverstößen am Arbeitsplatz haben tatsächlich kaum eine Möglichkeit, die ausländischen mitverantwortlichen Unternehmen auf Schadensersatz zu verklagen. Diese können für die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit im Ausland nicht zur Rechenschaft gezogen werden. So wies etwa Anfang 2019 das Landgericht Dortmund die Klage von vier pakistanischen Betroffenen der Ali Enterprises-Katastrophe vom September 2012 wegen Verjährung ab. Da sich das Unglück in Pakistan ereignete, wurde der Fall nach pakistanischem Recht entschieden. Und danach waren die Ansprüche verjährt. Dieser Fall belegt, dass die Verantwortung deutscher Unternehmen für ihre Zulieferfirmen juristisch völlig unzureichend geregelt ist.
UNO-Leitlinien und Nationaler Aktionsplan
Die im Jahr 2011 von den Vereinten Nationen verabschiedeten „Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ reflektieren dieses Defizit, indem sie auf die Schutzpflicht des Staates zur Einhaltung der Menschenrechte – auch gegen Übergriffen von Dritten, zum Beispiel Unternehmen – verweisen. Allerdings sind die Vorgaben als nicht rechtlich bindend formuliert und setzen deshalb auf Empfehlungen als Steuerungsinstrument. So heißt es etwa: „Staaten sollten klar die Erwartung zum Ausdruck bringen, dass alle in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen und/oder ihrer Jurisdiktion unterstehenden Wirtschaftsunternehmen bei ihrer gesamten Geschäftstätigkeit die Menschenrechte achten“, oder so schlicht wie zahnlos: „Wirtschaftsunternehmen sollten die Menschenrechte achten“.
Im Dezember 2016 setzte Deutschland die UN-Leitprinzipien in Form des „Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte“ um. Auch hier verzichtet die Bundesregierung auf verbindliche, strafbewehrte Regelungen für deutsche Unternehmen, baut stattdessen auf das Prinzip der „freiwilligen Selbstverpflichtung“. Originalton: „Die Bundesregierung erwartet von allen Unternehmen, den im Weiteren beschriebenen Prozess der unternehmerischen Sorgfalt mit Bezug auf die Achtung der Menschenrechte in einer ihrer Größe, Branche und Position in der Liefer- und Wertschöpfungskette angemessenen Weise einzuführen.“
In diesen Kontext gehört auch das von der Bundesregierung im Oktober 2014 als Reaktion auf die tödlichen Unfälle in Bangladesch und Pakistan ins Leben gerufene „Bündnis für nachhaltige Textilien“, das offiziell auf eine Verbesserung der Produktions- und Umweltbedingungen in der weltweiten Textilproduktion zielt – „von der Rohstoffproduktion bis zur Entsorgung“. Nach über fünf Jahren beteiligen sich aber nur etwa 50 Prozent der Unternehmen aus der Textilbranche an dem Zusammenschluss, bestehend aus Vertreter*innen der Wirtschaft, von Nichtregierungsorganisationen (NGO), Gewerkschaften und der Bundesregierung. Es überrascht nicht, dass sich auch das Textilbündnis an den unverbindlichen internationalen Vereinbarungen und Leitlinien orientiert und damit auf rein freiwillige Maßnahmen setzt.
Der „Grüne Knopf“
Im September 2019 brachte dann Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) mit dem „Grünen Knopf“ ein zusätzliches Steuerungsinstrument an den Start: ein staatliches Textilsiegel. Und reicherte damit den bereits bestehenden Siegel-Dschungel weiter an. Ein Siegel, das den Verbrauchern zwar Orientierung verspricht, aber angesichts Dutzender anderer Labels, die ebenfalls für „ökologische und soziale Nachhaltigkeit“ bürgen sollen, wohl eher für Verwirrung als für mehr Klarheit sorgen wird. Mit dem Siegel sollen die Produkte von Unternehmen ausgezeichnet werden, die – so der politische Fachjargon – in ihrem „Lieferketten-Management“ transparent sind und aufzeigen können, dass und wie ihre Produkte sozial und ökologisch „fair“ hergestellt werden.
Minister Müller bei der offiziellen Präsentation des „Grünen Knopfes“ am 9. September 2019: „Fair Fashion ist ein Mega-Trend. Für drei Viertel der Verbraucher ist faire Kleidung wichtig. Doch bisher fehlt die Orientierung. Mit dem Grünen Knopf ändert sich das. Mit jeder Kaufentscheidung können wir jetzt einen Beitrag leisten: Für eine gerechte Globalisierung, bei der Mensch und Natur nicht für unseren Konsum ausgebeutet werden. Für Menschlichkeit und Humanität“.
NGOs wie zum Beispiel medico international kritisieren das staatliche Siegel, weil einmal mehr an Unternehmen appelliert wird, bestimmte Standards einzuhalten, ohne dass sie dazu rechtlich verpflichtet werden. Wer nicht mitmachen will, darf weiter schädlich für Mensch und Natur produzieren wie bisher. Im Fokus der Maßnahme stehen dagegen die Konsumenten, denen eine Entscheidungshilfe beim Kauf von Textilien angeboten wird. Letztlich wird ihnen die Verantwortung für Menschenrechtsverbrechen entlang der Lieferketten aufgebürdet.
Die Überprüfung der Unternehmen und ihrer Produkte erfolgt durch Privatfirmen, die von den Unternehmen als Auftraggeber bezahlt werden. Mit diesem System wurden bisher überwiegend negative Erfahrungen gemacht. Die entwicklungspolitische Expertin und Autorin Gisela Burckhardt stellt in ihrem 2014 erschienenen Buch „Todschick“ fest, dass sich das Geschäft mit Zertifikaten sowie Audits in asiatischen Bekleidungsfabriken zu einer „wahren Goldgrube für Prüfgesellschaften“ entwickelt habe und zu einem „Milliardengeschäft“ geworden sei. „Was zählt, ist das Stück Papier, das eine Überprüfung der jeweiligen Fabrik bescheinigt. Details will niemand wissen – auch nicht wie die Fabrik eigentlich zu diesem Zertifikat gekommen ist.“ (Seite 107f.)
Die Autorin führt in ihrem Buch eine Reihe von Unternehmen an, bei denen massive Defizite im sozialen Bereich (fehlende Organisationsfreiheit, erzwungene Überstunden) sowie beim Arbeits- und Gebäudeschutz auftraten mit zum Teil verheerenden Folgen (Brände, eingestürzte Gebäude). In allen Fällen lagen von „unabhängigen“ Prüfern ausgestellte Zertifikate vor, die die Einhaltung der Unternehmens- und Produktkriterien bescheinigten. Aber auch die definierten Standards selbst sind teilweise mehr als fraglich. Beispielsweise erhält den „Grünen Knopf“ bereits jedes Unternehmen, welches garantiert, dass die Beschäftigten vor Ort den gesetzlichen Mindestlohn erhalten. Der aber bewegt sich in asiatischen Ländern nicht annähernd auf existenzsicherndem Niveau.
Lieferkettengesetz anstatt freiwillige Standards
Damit deutsche Unternehmen nicht länger mit der Verlagerung der Produktion in Billigstlohnländer auch ihre unternehmerische Verantwortung abschütteln können, fordern Vertreter*innen entwicklungspolitischer NGOs seit Jahren eine gesetzliche Regelung mit klaren strafbewehrten Regelungen, die die rechtliche Lücke schließt und die Achtung der Menschenrechte in den globalen Lieferketten verbindlich vorgibt. Deshalb stellte sich im September 2019 in Berlin die „Initiative Lieferkettengesetz“ vor, ein breites Bündnis aus 64 zivilgesellschaftlichen Organisationen, zu deren Initiatoren unter anderen Brot für die Welt, Misereor, Greenpeace und Oxfam zählen, aber auch der DGB und die Gewerkschaft ver.di.
In einer Petition fordert das Bündnis die Bundeskanzlerin auf, „endlich einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, mit dem Unternehmen dazu verpflichtet werden, sich an Menschenrechte und Umweltstandards zu halten“. Ein eigener Gesetzesvorschlag wird zwar nicht präsentiert, aber zentrale Anforderungen für ein wirksames Lieferkettengesetz formuliert.
Danach sollen alle Unternehmen erfasst werden, die in Deutschland geschäftstätig und für die gesamte Lieferkette von der Rohstoffgewinnung bis zur Abfallentsorgung verantwortlich sind. Sie werden verpflichtet, die Risiken und möglichen Auswirkungen ihrer Geschäfte für Menschenrechte und Umwelt zu ermitteln, sie zu analysieren und „angemessene Maßnahmen zur Prävention bzw. zur Abmilderung von Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden [zu] ergreifen“ (vgl. Hintergrundpaper: Die Initiative Lieferkettengesetz, September 2019).
Unternehmen haben zudem die Einhaltung der Sorgfaltspflichten zu dokumentieren und öffentlich darüber zu berichten. „Lückenhafte oder fehlerhafte Berichterstattung sollte dabei an Konsequenzen wie Bußgelder oder den Ausschluss von öffentlichen Aufträgen geknüpft sein.“ Ein Lieferkettengesetz muss neben dem Präventionsgedanken („Sorgfaltspflicht“) außerdem eine Haftung vorsehen, „wenn ein Unternehmen keine angemessenen Sorgfaltsmaßnahmen ergriffen hat, um einen vorhersehbaren und vermeidbaren Schaden zu verhindern“. Geschädigten ausländischen Betroffenen muss der Zugang zur bundesdeutschen Justiz ermöglicht werden, damit sie auch vor deutschen Gerichten ihr Recht einfordern können.
Beide Komponenten sollen über die Verwaltungsrechts- und die Zivilrechtsschiene durchgesetzt werden (mit verwaltungs- und zivilrechtlichen Sanktionsmitteln). Würde ein solches Gesetz eingeführt, hätten Unternehmen, die im Ausland Menschenrechte ignorierten, zumindest Bußgelder und Zivilklagen zu fürchten. Der Fokus liegt ausdrücklich nicht auf dem Strafrecht. Vielmehr ergänzt die Intervention der Initiative die davon unabhängig laufende Forderung, endlich auch in Deutschland ein Unternehmensstrafrecht als Mechanismus einzuführen, um juristische Personen wie Unternehmen und Verbände im Falle von Wirtschaftskriminalität mit strafrechtlichen Sanktionen belegen zu können.
Die derzeitige Praxis, Menschenrechtsverletzungen auf globaler Ebene in erster Linie mit den Mitteln des sogenannten Soft Laws, also mit Leitlinien und Übereinkünften, die im engeren Sinne nicht rechtsverbindlich sind, bewältigen zu wollen, „stellt letztlich eine Bankrotterklärung demokratischer Institutionen dar, die nicht (mehr) für einen Ausgleich zwischen Gemeinwohlbelangen und Wirtschaftsinteressen sorgen wollen“. (Kaleck/Saage-Maaß, Seite 43)
Während die internationalen Wirtschaftsbeziehungen über ein dichtes rechtliches Normenwerk abgesichert werden und sich dort unternehmerische Interessen über verbindliches Recht durchsetzen lassen (zum Beispiel mittels Investitionsschutzabkommen und Vertragsrecht), entledigen sich Unternehmen der Verantwortung gegenüber ihren Lohnarbeiter*innen über das System der globalen Lieferketten. Die Forderung nach einem Lieferkettengesetz zeigt einmal mehr, dass das Recht den herrschenden Machtbeziehungen immer wieder hinterherläuft.
Literatur:
Gisela Burckhardt: Todschick. Edle Labels, billige Mode – unmenschlich produziert, München 2014.
Wolfgang Kaleck/Miriam Saage-Maaß: Unternehmen vor Gericht. Globale Kämpfe für Menschenrechte, Berlin 2016.
Wirtschaft und Menschenrechte. Das Ende der Freiwilligkeit (ein Dossier von Brot für die Welt und Misereor in Zusammenarbeit mit der Redaktion „Welt-Sichten“), in: Welt-Sichten, 6/2019.
Joachim Maiworm
lebt und arbeitet in Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von BIG Business Crime.