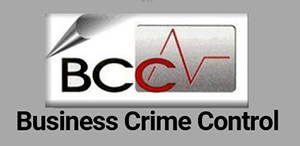Kaum etwas verdeutlicht die Hackordnung in spätkapitalistischen Gesellschaften so deutlich wie die Prioritätensetzung bei den historisch beispiellosen Hilfs- und Konjunkturprogrammen, die angesichts der Corona-Krise aufgelegt oder zumindest angekündigt worden sind.
Da soll noch mal jemand behaupten, der Kapitalismus sei auf seine alten Tage innovationsmüde geworden. Mit Ausbruch der Corona-Krise, deren Folgen die Bundesregierung nun mit einem Konjunkturpaket zu mildern sucht, entwickelten findige Betrüger in Windeseile neue Maschen, um Gelder bei all jenen Menschen abzugreifen, die wirtschaftlich unter Druck gerieten und Soforthilfen für Selbstständige erhielten. (1) Mit gefälschten Behördenmails, die ihre Empfänger zur Angabe unrechtmäßig erhaltener Hilfsgelder auffordern, sollte gezielt die Unsicherheit rund um die entsprechenden „Soforthilfen“ des Bundes und der Länder ausgenutzt werden. Offensichtlich wollten die Betrüger jene Selbstständige, die bereits Hilfsgelder erhalten haben, dazu bringen, diese an die angebliche „Behörde“ teilweise oder vollständig zurückzuüberweisen.
Den Hintergrund dieser Masche bildet die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung der Soforthilfen für Selbstständige und ihrer tatsächlichen rechtlichen Ausgestaltung. Der Bund hat sich bei der engen Auslegung der Finanzierungsmöglichkeiten für Solo-Selbstständige gegenüber den Ländern durchgesetzt. Dadurch dürfen diese Gelder nicht dazu verwendet werden, Einnahmeausfälle zu kompensieren. Stattdessen können hierbei nur laufende Betriebskosten wie Miete, Leasing oder Kredite geltend gemacht werden. Dieses führt folglich dazu, dass besonders bedürftige Selbstständige wie Freiberufler oder Künstler, die geringe laufende „Betriebskosten“ haben, kaum von den medial groß angekündigten Soforthilfen profitieren. Deswegen kursieren bereits im Bundeswirtschaftsministerium Schätzungen, dass tausende von Solo-Selbstständigen ihre Hilfsgelder letztendlich zurückzahlen müssen. (2) Die eingangs erwähnte Betrugsmasche nutzt punktgenau diese Verwirrung und Unsicherheit aus, um Selbstständige in eine Falle tappen zulassen.
Solche findigen Gauner sind allerdings nur die kleinen Fische beim großen Absahnen im Gefolge der billionenschweren Krisenpakete, die in den Zentren des Weltsystems in Windeseile geschnürt werden, um den im Gefolge des aktuellen Krisenschubs drohenden Wirtschafkollaps buchstäblich um jeden Preis zu verhindern. Wenn man sich in der richtigen gesellschaftlichen Position befindet, scheint es nun so, als ob Manna vom Himmel fallen würde. Es ist ein warmer Geldregen, der aber nur für all jene niedergeht, die ihn sich auch leisten können.
Eine Nummer größer als bloße Betrüger sind die in der rechtlichen Grauzone operierenden Geschäftemacher, die Lücken in der Gesetzgebung ausnutzen, um so richtig abzusahnen. Kurz nach Verabschiedung der Corona-Maßnahmen wollte beispielsweise alle Welt Unternehmensberater werden. Das Bundeswirtschaftsministerium meldete Ende April, dass binnen kürzester Zeit mehr als 8.500 Anträge auf offizielle Akkreditierung als Wirtschaftsberater dem Hause vorlagen. (3) Bei einem großen Teil all dieser Antragssteller, die sich plötzlich in die abenteuerliche Welt der Unternehmensberatung zu stürzen suchen, dürfte es sich schlicht um Trittbrettfahrer handeln, die auf die Schnelle Kasse machen wollen.
Am Anfang dieser großen deutschen Unternehmensberaterschwemme stand die behördliche Sorge um das Wohlergehen der deutschen Wirtschaft in der kommenden Wirtschaftskrise. Wer könne Unternehmen besser darüber beraten, wie man schwere Zeiten übersteht, als Unternehmensberater? Folglich legte das Wirtschaftsministerium ein Programm auf, in dessen Rahmen Unternehmen Hilfsgelder von bis zu 4.000 Euro beantragen konnten, um damit die Dienstleistungen von Unternehmensberatungen in Anspruch nehmen zu können. Dies sollte keine große Sache werden; es war nur eine Maßnahme unter vielen Projekten im gigantischen Krisenpaket der Bundesregierung. Diese beschloss immerhin eine Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro – zuzüglich Wirtschaftsgarantien von rund 600 Milliarden. (4) Für Beratertätigkeiten waren hierbei ursprünglich nur rund 15 Millionen Euro vorgesehen. Mitte Mai lagen beim Bundeswirtschaftsministerium hingegen schon 27.534 Anträge auf Finanzierung einer Beratertätigkeit vor, die den Steuerzahler wohl bis zu 100 Millionen Euro kosten werden.
Das sogenannte „Programm zur Förderung unternehmerischen Know Hows“ des Wirtschaftsministeriums hat folglich zu einem stürmischen Konjunkturaufschwung in der Beraterbrache geführt. Dies belegen nicht nur die vielen Anträge auf Zulassung. Inzwischen wetteifern Wirtschaftsberater darum, möglichst viele Kunden dazu zu bringen, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Es seien nun aber „viele unseriöse Anbieter“ auf dem Markt tätig, hieß es bei der Süddeutschen Zeitung (SZ). Diese würden mitunter ganze Berufsgruppen mit Massenmails abgrasen, um möglichst viele Aufträge einheimsen zu können. Manchmal würden schlicht „kostenfreie Marketingkonzepte“ durch einige „Scharlatane“ versprochen, so die SZ. Diese berichtete von einem Fall, in dem ein Verbund von 30 Finanzberatern einen Unternehmensberater sucht, der für jeden der Beteiligten einen Antrag stellt. So will man 120.000 Euro kassieren, die dann teilweise in einen „neuen Marketingauftritt“ investiert werden sollen. Der Fantasie der Märkte sind beim Thema Freigeld offensichtlich kaum Grenzen gesetzt.
Mitunter werden marktschreierische Werbemethoden verwendet: Man kriege „4000 Euro geschenkt“, jubelten Berliner Unternehmensberater in einem Werbevideo. Dieses versprach potenziellen Unternehmenskunden, dass sie im Rahmen ihrer Dienstleistungen noch weitere staatliche Hilfsgelder wie Kurzarbeitergeld oder staatliche „Corona-Hilfen“ abgreifen könnten – obwohl laut Bundeswirtschaftsministerium solche „Förderberatungen“ nicht förderfähig seien. Laut SZ gibt es inzwischen Überlegungen, wie dem evidenten Missbrauch vorgebeugt werden könne. Jedoch scheint das Programm eben diesen Missbrauch geradezu zu provozieren. Zum einen werden die Gelder direkt an die Berater und nicht an tatsächlich beratungsbedürftige Kleinunternehmen und Mittelständler überwiesen. Zum anderen gibt es keine Vorgaben zur prozentualen finanziellen Selbstbeteiligung: Unternehmen und Berater müssen nicht, wie sonst üblich, eigene Finanzmittel beisteuern. Der Bund, der bei selbstständigen Künstlern und Kulturschaffenden peinlich drauf achtet, keinen Cent zu viel aufzuwenden, ist gerade bei der windigen Branche Unternehmensberatung ungewöhnlich locker vorgegangen.
Noch lockerer handhabt der Staat aber die Vergabe von Hilfsgeldern und Krediten bei Großunternehmen – also in Größenordnungen, wo 4.000 Euro nicht mal mehr als „Peanuts“ wahrgenommen werden. Jeder Lohnabhängige, der mal Hartz IV beantragen musste, denkt mit Grauen an den entsprechenden Formularberg, bei dessen Ausfüllung alle finanziellen Umstände der Betroffenen genaustens beleuchtet werden. Sobald milliardenschwere Konzerne die Hand aufhalten, nimmt man es in Berlin hingegen nicht mehr so genau. Es hätten sich bereits tausende von Unternehmen um staatliche Corona-Hilfen bemüht, hieß es schon Ende April in Medienberichten, doch dieselben Behörden, die bei Hartz-Opfern ganz genau hinschauen, würden sich kaum für die Steuermoral all der Unternehmen interessieren, die nun die Hand für all die Euro-Milliarden offenhalten. (5)
Es sind gerade international tätige Großunternehmen, die zumeist umfassende Möglichkeiten zur Steuervermeidung nutzen, indem Gewinne und Verluste konzernintern so lange umgebucht werden, bis die tatsächliche Steuerquote auf ein Minimum gedrückt wird. Eine unter den für die Geldvergabe verantwortlichen Verwaltungen durchgeführte Umfrage ergab, dass in der Bundesrepublik Antragssteller kaum darauf durchleuchtet würden, ob sie in der Vergangenheit Steuertricks anwandten. Diese Methoden der Steuervermeidung, die sich oftmals in einer rechtlichen Grauzone befinden, gelten in anderen Ländern hingegen als Ausschlussgrund bei der staatlichen Kredit- und Subventionsvergabe in der Corona-Krise. Mehrere Länder, unter anderem Dänemark und Polen, haben beispielsweise erklärt, dass Konzerne mit einem Hauptsitz in Steueroasen keine Hilfen erhalten würden. Der deutsche Staat würde hingegen die gigantischen Corona-Hilfen nicht dazu nutzen, um mit strengen Vergaberichtlinien einer üblichen Praxis von Großunternehmen oder international tätigen Konzernen ein Ende zu bereiten: der Privatisierung der Gewinne und der Sozialisierung der Verluste. Man schaue jetzt „nicht so genau hin, wie mal eigentlich sollte“, klagte auch die Deutsche Steuergewerkschaft angesichts der lockeren Vergabepraxis des Bundes.
Der historisch beispiellose Krisenschub des kapitalistischen Weltsystems, der durch die Pandemiemaßnahmen getriggert wurde, führt aber tatsächlich viele Unternehmer in wirtschaftliche Schwierigkeiten, sodass sich auch die „Kapitäne“ der freien Wirtschaft zu großen Opfern genötigt sehen. Dies macht das Beispiel eines Auto-Pfandhauses in der von Schweizer Staatsgebiet umgebenen deutschen Exklave Büsingen evident. Nach Ausbruch der Wirtschaftskrise suchten in finanzielle Schieflage geratene Schweizer Firmenchefs das Pfandhaus auf, wollten ihre teuren Luxusschlitten gegen Bares verpfänden, um so ihren Laden über Wasser halten zu können. Die Parkflächen füllten sich schnell mit Ferraris, Rolls Royces und Aston Martins.
Dies änderte sich Ende März nach der Verabschiedung entsprechender Hilfsprogramme in der Schweiz. Seitdem Hilfsgelder an die Wirtschaft fließen, würden „auffällig viele Luxusautos von Unternehmen wieder abgeholt“, erklärte ein Mitarbeiter des Pfandhauses gegenüber den Medien. (6) Man sei sich darüber im Klaren, dass „viele Kunden die Notkredite zum Rückkauf ihres Pfandkredits verwenden, den sie ursprünglich mit ihrem Auto gedeckt hatten“. Es gehe dabei meistens um hohe fünfstellige Beträge. Die Schweiz hat solche Refinanzierungsdeals eigentlich verboten, doch böten die Autopfandkredite ein Schlupfloch, da darüber keine Meldungen an die entsprechenden Informationsstellen gemacht werden müssten. Die meisten Deals laufen bequem über Bargeld ab, sie hinterlassen somit keine Spuren. Folglich können arme Schweizer Unternehmer ihr geliebtes Statussymbol schnell wieder in die heimische Garage überführen – dank üppiger Staatshilfen. Es ist ein Sozialismus für Reiche, der alle diesbezüglichen Klischees vollauf erfüllt.
Werden aus den Millionen erstmal Milliarden, so ist nahezu alles möglich. The sky is the limit. Mitte Mai konnte sich eine der reichsten Milliardärsfamilien der Bundesrepublik, die BMW-Großaktionäre und Erben der Quandt-Familie, über eine Dividendenausschüttung von vielen Millionen Euro freuen – mitten in einer schweren Systemkrise. Stefan Quandt, der rund 25 Prozent an BWM hält, kann sich an einem warmen Geldregen von 425 Millionen Euro ergötzen. Seine Schwester, Susanne Klatten, die etwa 20 Prozent hält, muss sich mit 344 Millionen begnügen. (7) Ungeachtet aller öffentlichen Kritik behauptet der BWM-Chefmanager Oliver Zipse, der Konzern würde in seiner Dividendenpolitik „zuverlässig“ handeln. Überdies sei die Erfolgsbeteiligung der Belegschaft, von der sich rund ein Drittel in steuerfinanzierter Kurzarbeit befand, an die Ausschüttung der Dividende von insgesamt 1,6 Milliarden Euro gekoppelt.
Diese Entscheidung des Quandt-Clans, dem Konzern mitten in der schwersten Rezession der Unternehmensgeschichte Milliarden zu entziehen, erweckt den Eindruck, als ob die Ratten das sinkende Schiff verließen. Die guten Zeiten der Autobranche sind gezählt, also nimmt man noch alles mit, was geht, um in ein paar Jahren die Kosten der Sanierung oder Abwicklung zu sozialisieren. Doch zugleich stellt dieses Vorgehen des bajuwarischen Autobauers einen direkten Affront gegen Finanzminister Olaf Scholz dar. Um sich gegen den Vorwurf der Verschwendung von Steuergeldern zu wehren, hatte dieser Ende April erklärt, dass „Nothilfen“ für Deutschlands Konzerne nur unter „strengen Auflagen“ gezahlt würden. (8) Dabei behauptete Scholz, dass alle Unternehmen, die Dividenden oder Boni auszahlten, von den Staatsgeldern ausgeschlossen würden.
Dem Quandt-Clan, der durch Zwangsarbeit im Dritten Reich richtig groß wurde, kann doch nicht ernsthaft zugemutet werden, in einer schweren Systemkrise auf den gewohnten warmen Geldregen zu verzichten. Dabei hat nicht nur BMW mit seiner milliardenschweren Dividendenausschüttung den Finanzminister in die Schranken verwiesen. Ausschüttungen von Dividenden in Milliardenhöhe planen auch andere PKW-Produzenten und Zulieferer der Autobranche wie Continental, Daimler oder Volkswagen. Dennoch rechnete Deutschlands Oligarchie und Oberschicht mit der Zahlung weiterer Steuermilliarden an in ihrem Besitz befindlichen Konzerne, insbesondere in Gestalt von Kaufprämien. Auch BMW forderte eisern „Kaufanreize“ für seine Produkte. Der noch Anfang Mai beim „Autogipfel“ in Berlin deutlich spürbare Widerstand der Bundesregierung (9), der dividendenfreudigen Autobranche krisenbedingt mit milliardenschweren Subventionen unter die Arme zu greifen, schien Ende des Monats bereits wieder verflogen. (10)
Der Druck der Autolobby – mitunter ausgeübt durch die um Standorte und Arbeitsplätze besorgten Landesregierungen – ist immens. Laut ersten inoffiziellen Details sollten nämlich trotz Klimakrise nicht nur Elektroautos von den Kaufprämien profitieren, sondern auch gewöhnliche Spritfresser mit einem CO2-Ausstoss von bis zu 140 Gramm. Erst Proteste und breite öffentliche Empörung brachten es fertig, den „Autogipfel“ Anfang Juni, auf dem die Subventionen offiziell beschlossen werden sollten, vorerst abzusagen. Stattdessen sollte zuerst eine Koalitionsrunde über das Vorhaben beraten. (11) Dass der erhoffte Beschluss nun doch nur für Elektroautos zustande kam, war dann für die Autolobby zwar eine herbe Enttäuschung. Die stattdessen als Kaufanreiz beschlossene Reduzierung der Mehrwertsteuer sorgte jedoch für einhelligen Beifall im Unternehmerlager.
Da Deutschlands notleidende Auto-Oligarchie sich verbissen um Milliardenbeträge bemüht, darf der Staat auch notleidende Spekulanten nicht vergessen. Heinz Herrmann Thiele bleibt lieber im Hintergrund. Der Investor und Großaktionär zählt immerhin zu den zehn reichsten Bundesbürgern – also zu jener Gesellschaftsschicht, die sich Verschwiegenheit und Diskretion auch leisten kann. Kurz nach Ausbruch der Pandemie, als die Aktie der Lufthansa abschmierte, investierte Herr Thiele viel Kapital in den Kauf von Wertpapieren dieser Fluggesellschaft, sodass er mit einem Anteil von rund zehn Prozent über Nacht zu deren größtem Anteilseigner aufsteigt. (12) Dieses Investment verfolgt somit den Zweck, von einer Rettung der Lufthansa durch den Staat zu profitieren. Es ist letztendlich eine Spekulation auf Staatsgelder. Der „Vorzeigebetrieb“ in Thieles Imperium, der Autozulieferer Knorr-Bremse, profitiert ebenfalls von der Kurzarbeitergeldregelung. Zugleich strich Herr Thiele 200 Millionen Euro bei der Dividendenausschüttung seines Betriebs ein, den er zu 70 Prozent kontrolliert. Milliarden kassieren und Milliarden an Staatsgeldern abgreifen – dies scheint im Krisensozialismus die neue Norm zu sein, die all jenen zugutekommt, die es sich leisten können.
Was bleibt von den Krisen-Geldern übrig, angesichts eines drohenden Steuerloches von fast 100 Milliarden Euro (13) – nachdem all jene kräftig bedient wurden, die sich eine gute Lobbyarbeit in Berlin finanzieren können? Es gibt Dinge, die man sich in Krisenzeiten – wenn es mal wieder gilt, Konzerne und Banken mit vielen Milliarden Euro zu stützen – schlicht nicht leisten kann. Nahrung zum Beispiel. In der Bundesrepublik als einem der reichsten Länder der Welt sind ohnehin Millionen Menschen von Mangelernährung betroffen. Die Corona-Pandemie hat die Situation noch zusätzlich zugespitzt, weil sich die Betroffenen aufgrund explodierender Preise für Frischprodukte ausreichende Mengen von Obst und Gemüse schlicht nicht kaufen können.
Ende April appellierten Verbraucherorganisationen folglich an die SPD, die zu Beginn der Corona-Pandemie gemachten Zusagen einzuhalten und die Hartz-IV-Sätze anzuheben (14), um die bereits gegebene Mangel- und Unterernährung insbesondere unter den Kindern von Hartz-IV-Beziehern nicht noch weiter ansteigen zu lassen. (15) Die NGO Foodwatch, die ein Sofortprogramm gegen Ernährungsarmut fordert, nannte hierbei eine ganze Reihe von Krisenfaktoren, die die marginalisierten Bevölkerungsschichten der Bundesrepublik in die Mangel nehmen.
Viele Tafeln, bei denen sich verarmte und marginalisierte Menschen versorgten, haben inzwischen dicht gemacht. Zudem seien die kostenlosen Schulessen ausgefallen, die für die Ernährung sozial benachteiligter Kinder wichtig seien. Frische Lebensmittel wie Gemüse seien im April dieses Jahres um rund 27 Prozent teurer als im Vorjahreszeitraum. All jene sozial abgehängten Menschen, die seit der Durchsetzung von Hartz-IV ihren Nachwuchs mit 4,09 Euro täglich ernähren müssen, stellt diese Situation vor ein unlösbares Problem.
Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken versprach in einer Stellungnahme eine Klärung, ob vorübergehende Mehrbedarfe der Hartz-Opfer tatsächlich gegeben seien, wollte gegebenenfalls in Gesprächen mit dem Koalitionspartner CDU/CSU eruieren, welche zusätzlichen Maßnahmen eventuell beschlossen werden könnten. Nur zwei Wochen später, Mitte Mai, stimmte die SPD – gemeinsam mit CDU/CSU, FDP und AfD – gegen den von den Grünen und der Linkspartei eingebrachten Antrag auf Erhöhung der Hartz-Sätze um eine Corona-Zulage. (16)
Anmerkungen:
(1) „Betrüger verschicken gefälschte Mails“, tagesschau.de, 05.Mai.2020
(2) „Bericht: Tausenden Soloselbstständigen droht Rückzahlung der Corona-Soforthilfen“, RND.de, 23. April 2020
(3) „Wie selbsternannte Unternehmensberater an Hilfsgeld gelangen wollen“, sueddeutsche.de, 14. Mai 2020
(4) „156 Milliarden gegen die Corona-Krise“, tagesschau.de, 25. März 2020
(5) „Staat zahlt Corona-Hilfen an Steuer-Trickser“, sueddeutsche.de, 22. April 2020
(6) „Unternehmer kaufen mit Corona-Nothilfen ihre verpfändeten Luxusschlitten zurück“, focus.de, 25. Mai 2020
(7) „Mangel an Gemeinschaftsgefühl: BMW löst eine Welle der Empörung aus – werden Söders Pläne durchkreuzt?“, merkur.de, 18. Mai 2020
(8) „Scholz betont strenge Auflagen für Nothilfen“, n-tv.de, 26. April 2020
(9) „Deutschland: Vorerst keine Wiederauflage der Abwrackprämie“, kurier.at, 5. Mai 2020
(10) „Die Kaufprämie ist falsch, aber sie kommt“. rp-online.de, 28. Mai 2020
(11) „Der „Autogipfel“ im Kanzleramt fällt aus“, berliner-zeitung.de, 29. Mai 2020
(12) „Corona: Hilfe für Milliardäre?“, daserste.ndr.de, 14. Mai 2020
(13) „Corona-Krise reißt Steuerloch von fast 100 Milliarden Euro in die Kassen“, welt.de, 14. Mai 2020
(14) „Mehr Hartz IV wegen Corona“, taz.de, 30. April 2020
(15) „Viele deutsche Kinder sind mangelernährt – Armut ist ein großer Faktor“, web.de, 3. Februar 2018
(16) „Wenn die Lobby fehlt: Bundesregierung verweigert Corona-Zuschüsse für Arme“, rt.de, 19. Mai 2020
Tomasz Konicz arbeitet seit etwa 15 Jahren als freier Journalist und Buchautor. In BIG Business Crime Nr. 1/2015 erschien von ihm: „Geschäftsfeld Barbarei. Der Islamische Staat als global agierender Terrorkonzern“.