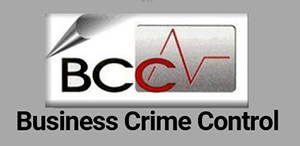Der Fall Wirecard bietet genügend Stoff für nicht nur einen Krimi. Die meisten Medienberichte fokussieren sich deshalb auf das betrügerische Verhalten der beiden Spitzenmanager Markus Braun und Jan Marsalek. Der eine sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft, der andere steht als einer der meistgesuchten Verbrecher Europas auf internationalen Fahndungslisten.
Diese dominierende individualisierende Perspektive lenkt jedoch von strukturellen Faktoren ab, die überhaupt erst die Voraussetzungen dafür schufen, dass der Konzern mutmaßlich über viele Jahre seine Bilanzen in gigantischem Ausmaß frisieren konnte, um sich gegenüber Banken und Investoren finanzstärker und attraktiver präsentieren zu können, als er es jemals war.
Es muss aber vor allem das gesellschaftliche und politische Umfeld untersucht werden, um kriminelles Verhalten in der Wirtschaft analysieren zu können. Wie verhalten sich Staat, Politik, Kapital und gesellschaftliche Gruppen zueinander? Wie ist es letztlich möglich, dass die Staatsanwaltschaft München I erst im Sommer 2020, fünf Jahre nachdem die Londoner Financial Times bereits Betrugsvorwürfe gegen Wirecard vorgebracht hatte, im Vorstandsvorsitzenden Markus Braun den „Kopf einer hierarchisch organisierten Bande“ erkannte, dem inzwischen „gewerbsmäßiger Betrug“ zur Last gelegt wird? (FAZ vom 13. Dezember 2020
„Wir haben es mit einem klaren Fall von Markt- und Staatsversagen zu tun.“ So lautet eine beliebte Antwort auf diese Frage. Das „Versagen“ eines Staates muss sich aber an dem messen lassen, was als „normal“ oder „erfolgreich“ gilt. Nach der statistischen Norm sind illegale Aktionen aufseiten von Unternehmen durchaus an der Tagesordnung. [1] Wann also beginnt das „Staatsversagen“? Offensichtlich erst dann, wenn der Öffentlichkeit klar wird, welch gigantischen Ausmaß der Betrug eines Unternehmens angenommen hat. Bis dahin verläuft alles ganz „normal“ unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle. Wesentliche Faktoren dieser die Wirtschaftskriminalität ermöglichende oder begünstigende Normalität lassen sich am Beispiel Wirecard benennen.
Fehlende externe und interne Kontrolle
Auf rein legalem Weg wäre der Wachstumskurs von Wirecard nicht möglich gewesen. Bereits als Start-up setzte das Unternehmen ab den 2000er Jahren auf die Zahlungsabwicklung im Pornogeschäft und beim Online-Glücksspiel, bewegte sich damit schon früh im Umfeld krimineller Milieus. Dennoch schauten die staatlichen Behörden in den folgenden Jahren weitgehend weg. Dem zunehmend global agierenden deutschen FinTech-Unternehmen sollten offensichtlich auf seiner Erfolgsspur keine Steine in den Weg gelegt werden. Mit wichtigen Kontrollmaßnahmen betraute öffentliche Institutionen spielten darum im Fall Wirecard eine schlicht erbärmliche Rolle: vor allem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS).
So soll etwa die dem Bundesfinanzminister unterstehende BaFin überwachen, ob sich Unternehmen gesetzeskonform verhalten, damit Geldwäsche, Anlagebetrug, Insiderhandel und Marktmanipulation verhindert werden können. Die Behörde war auch für Wirecard zuständig, allerdings nur für die hauseigene Bank. Sie versagte nach einhelliger Meinung der meisten Analysten vollständig. Denn zum einen blieb der weitaus größte Teil des Unternehmens außerhalb des Radars der externen Prüfer. Zum anderen sprach die BaFin Anfang 2019 ein Verbot für alle Leerverkäufe von Wirecard-Aktien aus. Sie stoppte damit Wetten auf Kursverluste – was von „den Märkten“ als Vertrauensbeweis für den Konzern gewertet wurde – und täuschte so potenzielle Anleger. Zudem stellte sich die BaFin vor den Skandal-Konzern, indem sie Strafanzeigen gegen kritische Journalisten stellte und damit den Eindruck erweckte, deren Enthüllungen seien haltlos. Als besonders pikant erwies sich die Meldung, dass BaFin-Mitarbeiter, die mit der Prüfung des Dax-Unternehmens betraut waren, offenbar ihr Insiderwissen nutzten, um privat mit deren Aktien zu handeln.
Auch die Wirtschaftsprüferaufsicht APAS geriet in die Kritik, weil ihr Leiter im Frühjahr 2020, als die APAS bereits im Fall Wirecard ermittelte, privat mit Wirecard-Aktien spekuliert hatte. Dies musste er später vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages einräumen. Erst im Sommer 2020 leitete die Behörde ein förmliches Verfahren gegen die Wirtschaftsprüfergesellschaft EY ein, lange nachdem EY selbst im öffentlichen Kreuzfeuer der Kritik stand.
Das Wirtschaftsprüferunternehmen EY, einer der „Big Four“ der Branche, prüfte von 2009 bis 2020 die Jahresabschlüsse und Bilanzen. Es bestand also eine große Nähe zum Konzern. Dass die Prüfer selbst 2019, als die kritischen Stimmen zu Unregelmäßigkeiten bei Wirecard nicht mehr zu überhören waren, das gewünschte Testat ohne Bedenken ausstellten, wundert daher nicht. Die Wirtschaftsprüfung ist zudem „oft nur die Eintrittskarte zu den lukrativen Geschäftsfeldern: Managementberatung, Steuerstrategien, Anlagemöglichkeiten“, wie es in einer ZDF-Reportage heißt. Der Beratungsanteil habe sich bei den großen Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaften in den letzten zehn Jahren stetig erhöht. Da bislang eine strikte Trennung von Beratung und Prüfung fehlt und die Unternehmen die privaten Prüfungsunternehmen als Auftraggeber bezahlen, scheint wegen der Interessenkollision eine objektive Prüfung der Bilanzen kaum möglich.
Der Aufsichtsrat bildete ebenfalls einen Teil des „Kontrollversagens“. Für die Überwachung des operativen Geschäfts des Dax-Unternehmens war er mit sechs Personen zu klein und der Vorsitzende Wulf Matthias viel zu lang im Amt, um unabhängig sein zu können. Er leitete das Kontrollgremium von 2008 bis Januar 2020. Kritische Stimmen verweisen auf die engen freundschaftlichen Verbindungen aller Mitglieder des Aufsichtsrats mit dem Management. Einige verfügten offensichtlich über keinerlei Erfahrung mit der Beaufsichtigung eines großen Unternehmens. Einen im Rahmen des Aufsichtsrats arbeitenden Prüfungsausschuss, in Dax-Konzernen eigentlich Standard, gab es nicht. Ein solcher hätte, mit Bilanzexpertise ausgestattet, eng mit den Wirtschaftsprüfern zusammenarbeiten müssen.
Opportunistische Wirtschaftspresse
Besonders fatal war, dass auch der größte Teil der deutschen Wirtschaftspresse darauf verzichtete, den von britischen Reportern und Börsenprofis aufgedeckten Betrügereien nachzugehen. So wurde Wirecard-Chef Braun noch Ende 2018 vom Handelsblatt als „Aufsteiger des Jahres“ gefeiert. Im Herbst desselben Jahres kommentierte die FAZ ehrfurchtsvoll die positive Geschäftsentwicklung unter dem Titel „Wirecard – eine Ermutigung“ (FAZ vom 31. August 2018). Eine Ausnahme im medialen Mainstream bildete die Redaktion des Magazins WirtschaftsWoche, welches sich, nachdem die Londoner Financial Times bereits umfängliche Aufklärung betrieben hatte, ebenfalls mit kritischen Beiträgen profilieren konnte. „Das ist definitiv ein Image-GAU für die deutsche Wirtschaftspresse“, stellte Beat Balzli, Chefredakteur der Zeitschrift, gegenüber ZDF-Redakteuren gelassen fest. Er erkannte „eine Art Paktieren der Wirtschaftspresse mit der Wirecard“, denn einen Börsenstar „runterzuschreiben“ sei offenbar vielen zu riskant gewesen. [2]
Unternehmenskultur
Nach Aussagen von Mitarbeitenden wurde das Unternehmen von Markus Braun, seit 2002 Boss von Wirecard, sowie den drei anderen Vorständen streng hierarchisch geführt. Corpsgeist und Treueschwüre gegenüber ihm als Führungsperson seien offenbar wichtig gewesen, wie die Münchner Staatsanwaltschaft feststellte. Nach Recherchen des Handelsblatts wussten im Unternehmen offensichtlich viele Angestellte von den betrügerischen Machenschaften oder ahnten zumindest davon. Kaum überraschend – es gab weder einen Betriebsrat noch eine Mitbestimmung auf Unternehmensebene.
Auch Aktionäre wandten sich auf Hauptversammlungen zumeist vehement gegen kritische Stimmen. Sie störten sich weniger an der fehlenden Transparenz des Geschäftsmodells, sondern ließen sich von der Bilderbuchgeschichte des kometenhaften Aufstiegs eines ehemaligen Start-up-Unternehmens blenden. Kritiker galten dagegen als Nestbeschmutzer. Die Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Daniela Bergdolt, hatte etwa im Mai 2019 auf der Hauptversammlung des Konzerns ihre Skepsis am Geschäftsmodell (nicht nachvollziehbare hohe Gewinne) geäußert – und als Reaktion wütende Aktionäre erlebt, die ihr vorwarfen, das angeblich tolle Unternehmen schlechtzureden. [3]
Anleger investierten bei Wirecard noch bis kurz vor dessen Absturz. Der US-amerikanische Finanzinvestor Apollo bot Wirecard noch am 17. Juni 2020 an, bis zu einer Milliarde Euro zu investieren – nur acht Tage vor dessen Insolvenz (Der Spiegel vom 23. Januar 2021). Auch der sportlich ruhmreiche FC Bayern München entging nach einer Recherche von Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR offenbar nur knapp einem Debakel. Im vergangenen Jahr stand das Management des Vereins kurz davor, eine Partnerschaft mit Wirecard einzugehen. Das Unternehmen sollte ab Juli 2020 jährlich einen Sponsoringbetrag von sieben Millionen Euro an den Münchener Klub zahlen. Noch am 10. Juni 2020 schrieb das verantwortliche Vorstandsmitglied des Fußballklubs per E-Mail an die Firmenzentrale des Finanzdienstleisters, dass sich der Verein auf die „Partnerschaft mit Wirecard“ freue (Die Welt vom 9. Februar 2021). Dabei hatten die Wirtschaftsprüfer der Firma KPMG bereits Ende April 2020 in einem Sondergutachten eine vernichtende Bewertung der Geschäftspolitik von Wirecard vorgelegt.
Nähe zur geheimdienstlichen Halbwelt…
Nach ZDF-Informationen könnte Marsalek als Zahlungskurier für verschiedene Geheimdienste im Einsatz gewesen sein und ihnen Kreditkarten zur Verfügung gestellt haben. Auch geostrategische Aspekte spielen eine Rolle: „In der Tat ist eine Firma wie Wirecard für Geheimdienste interessant: Laufen doch über Zahlungsabwickler Geldströme in alle Teile der Welt: Israelis wollen wissen, wohin der Iran seine Gelder lenkt. Amerikaner wollen wissen, wohin die Russen und die Chinesen Geld überweisen.“ [4]
Fabio de Masi, für die Partei Die Linke Mitglied des Wirecard-Untersuchungsauschusses, kann sich sogar vorstellen, dass Geheimdienste Marsalek frühzeitig in das Unternehmen gesetzt haben könnten, um an „spannende Informationen“ zu kommen und Aktivitäten der Nachrichtendienste zu verschleiern. Im Gegenzug hätte sich das Unternehmen „die Taschen vollmachen“ können. [5]
Geheimdienste, so berichteten Medien, hätten sicher Interesse an Informationen des Finanzdienstleisters gehabt, um personalisierte Geldbewegungen zur Aufdeckung von Geldwäsche-Aktivitäten krimineller Gruppierungen oder Einzelpersonen auswerten zu können. Wirecard – selber als Dienstleister entsprechender Milieus agierend und direkt an deren Aktivitäten beteiligt – könnte demnach staatlichen Behörden bei der Bekämpfung von Geldwäsche geholfen haben. Paradox ist dabei, dass das Unternehmen im Zuge seiner Geschäfte in der Porno- und Glücksspielbranche verbotene Zahlungen abwickelte, die vermutlich selbst dem Delikt der Geldwäsche entsprechen.
…und zur organisierten Kriminalität
Missliebige Kritiker wurden zum Teil mit Mafia-Methoden unter Druck gesetzt. Der britische Börsenexperte und Shortseller Fraser Perring hatte bereits im Jahr 2016 betrügerische Machenschaften von Wirecard enthüllt. Er warf deshalb Marsalek vor, kriminelle Aktionen gegen ihn und andere gesteuert zu haben. Bei Perring wurde beispielsweise eingebrochen, seine Krankenakte gehackt und ins Internet gestellt. Er fühlte sich massiv verfolgt und bedroht. [6] Ähnlich erging es dem Reporter von Financial Times, Dan McCrum. Wirecard warf kritischen Journalisten regelmäßig Betrug und Lüge vor. Sie würden gemeinsame Sache mit Shortsellern machen, mit ihren kritischen Berichten den Börsenwert des Unternehmens „nach unten schreiben“ und damit den Aktienpreis manipulieren.
Erhärten sich die derzeit von der Staatsanwaltschaft vorgebrachten Anschuldigungen gegen die Manager von Wirecard, kann das Unternehmen ohne weiteres als Teil der organisierten Kriminalität betrachtet werden. Denn nach der offiziellen deutschen Definition handelt sich bei organisierter Kriminalität (oK) um „die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, (…) wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Zeit arbeitsteilig a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder c) unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentlicher Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zusammenwirken“. [7]
„Privilegierte Komplizenschaft“ – das politische Netzwerk
Tatsächlich verfügten die beiden Spitzenleute von Wirecard, Markus Braun und Jan Marsalek, über ausgezeichnete informelle und formelle Kontakte in die Politik Österreichs und Deutschlands. Es wurden von Beginn an aber auch intensive Beziehungen zur „Halbwelt“, gepflegt. Durch seinen Sitz im Beirat der „Denkfabrik“ des Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) hatte CEO Braun einen unmittelbaren Zugang zur österreichischen Regierung. Auch Marsalek stammt aus Wien, gilt als undurchsichtige Figur mit guten Kontakten in die rechte Szene Österreichs (z. B. zur FPÖ) und stand mutmaßlich mit mehreren Geheimdiensten in Verbindung. [8]
Im August 2019 setzte sich der ehemalige deutsche Verteidigungsminister und heutige Unternehmensberater Karl-Theodor zu Guttenberg bei Bundeskanzlerin Angela Merkel dafür ein, das China-Geschäft des Unternehmens zu unterstützen. Merkel warb tatsächlich bei einer Chinareise für Wirecard, betonte später aber, dass sie damals keine Kenntnis von möglichen Betrügereien des Unternehmens gehabt habe. Zu diesem Zeitpunkt waren die Vorwürfe gegen den Konzern allerdings bereits seit vielen Monaten öffentlich bekannt.
Einen persönlichen Kontakt gab es auch zu Staatssekretär Jörg Kukies, Leiter des Verwaltungsrats der BaFin und enger Mitarbeiter von Finanzminister Scholz. Am 5. November 2019 trafen sich Kukies und Markus Braun zu einem Gespräch am Firmensitz von Wirecard, „ohne Zeugen, ohne Protokoll. In einer Phase, in der Prüfer der KPMG bereits Unregelmäßigkeiten festgestellt haben“, wie es in der ZDF-Doku vom 14. Januar 2021 hieß.
Formelle und informelle Verbindungen von Großunternehmen und herrschender Politik und die intensive Verflechtung von staatlichen, wirtschaftlichen, legalen und illegalen Strukturen werden deshalb gern als „privilegierte Komplizenschaft“ (Theodor W. Adorno) bezeichnet.
Fehlende Unterscheidbarkeit
Der Fall Wirecard zeigt anschaulich, wie die Grenzen zwischen legalen und illegalen Praktiken – vor allem bei global tätigen Konzernen – zerfließen. Dauerhaft kriminell agierende Wirtschaftsunternehmen lassen sich von Mafia-Organisationen kaum mehr unterscheiden. Wirecard verfolgte ein nach außen sichtbares legales Kerngeschäft und kombinierte es mit illegalen bzw. rein erfundenen Geschäften. [9] Auch Mafia-Gruppen verknüpfen illegale und legale Geschäftsaktivitäten, indem sie kriminell erwirtschaftete Gewinne in den legalen Wirtschaftskreislauf einschleusen (Geldwäsche). Gewinn und Beute werden so ununterscheidbar. Eine Ironie der Geschichte ist, dass neben der Berichterstattung der Financial Times ausgerechnet die Analysen britischer und US-amerikanischer Shortseller das kriminelle Vorgehen von Wirecard erst publik machten. In Deutschland sind die Shortseller, die auf sinkende Aktienkurse wetten, dennoch weithin verrufen. So wurden sie auch von der staatlichen Aufsichtsbehörde BaFin unter Beschuss genommen, um den digitalen Champion aus Aschheim bei München zu schützen.
Fazit
Der Rechts- und Staatswissenschaftler Wolfgang Hetzer stellte schon vor einigen Jahren die Frage, ob sich die oK nicht als „Wirtschaftsform“ und „politisches Prinzip“ längst etabliert habe. [10] Das Konstrukt Wirecard spricht dafür. Es hielt so lange, wie unterschiedliche Interessengruppen glaubten, davon profitieren zu können. Die ehemalige Konzernspitze konnte sich deshalb als Gangsterbande aufführen, setzte sich offensichtlich ohne große Widerstände und über viele Jahre gegen alle rechtsstaatlichen Mechanismen durch und steht unter Verdacht, sogar Gewalt gegen ihre Kritiker eingesetzt zu haben.
Die Hoffnung, dass die Politik dem Bandenwesen im digitalen Kapitalismus entschieden entgegentritt, ist dagegen gering. Aus industriepolitischen Gründen stellten sich die zuständigen Behörden vor das Unternehmen. Denn das Bekanntwerden des „bandenmäßigen Betrugs“ hätte schon frühzeitig einen Vertrauensverlust für den Finanzplatz Deutschland bedeutet. Und von politischen Vertretern wie Finanzminister Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, sollte ohnehin nicht allzu viel erwartet werden. Schließlich spielte er selber als Erster Bürgermeister Hamburgs im Cum-Ex-Skandal eine unrühmliche Rolle. Kritiker werfen ihm vor, mitverantwortlich dafür zu sein, dass sich eine stadtbekannte Bank Millionenbeträge auf Kosten der Steuerzahler erschleichen konnte.
Anmerkungen:
[1] So wurden zum Beispiel Schmiergeldzahlungen an Entscheidungsträger im Ausland bis 1999 vom deutschen Staat gedeckt. Da ihnen ein volkswirtschaftlicher Nutzen zugesprochen wurde, konnten sie von der Steuer abgesetzt werden. (vgl. BIG-Beilage in „Stichwort Bayer“ 1/2021)
[2] ZDFinfo Doku „Wirecard – Game Over, Geldgier, Größenwahn und dunkle Geheimnisse“ von Volker Wasmuth und Patrick Zeilhofer, 14. Januar 2021
[3] „Podcast Handelsblatt Crime: Der Fall Wirecard – Folge 4: Kritik wurde im Keim erstickt“ von Ina Karabasz und Felix Holtermann, 16. September 2020
[4] Volker ter Haseborg/Melanie Bergermann: Die Wirecard-Story. Die Geschichte einer Milliarden-Lüge, München, 2021, Seite 185
[5] ZDFinfo Doku, 14. Januar 2021
[6] ebd.
[7] Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2019, hrsg. vom Bundeskriminalamt (BKA), Seite 11
[8] „Podcast Handelsblatt Crime: Der Fall Wirecard – Folge 2: Die Männer hinter Wirecard – Markus Braun und Jan Marsalek“ von Ina Karabasz und Felix Holtermann, 2. September 2020
[9] So betrug der Teil des Umsatzes, der auf fiktiven Kundenbeziehungen basierte, im Jahr 2019 etwa 1,07 Milliarden Euro ‒ der offizielle Gesamtumsatz lag bei rund 2,77 Milliarden Euro. (vgl. Handelsblatt vom 2. Dezember 2020)
[10] Wolfgang Hetzer: „Finanzindustrie oder Organisierte Kriminalität?“, ApuZ, 38-39/2013, Seite 27