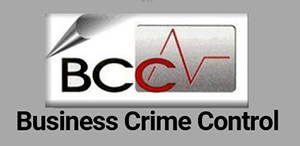Im Mai 2022 beschrieb Die Zeit ganzseitig den Persönlichkeitskult um Elon Musk, Chef von Tesla, Twitter und dem Raumfahrtunternehmen SpaceX. Für den TV-bekannten Start-up-Investor Frank Thelen ist er „der größte Architekt der Menschheitsgeschichte“. Die Kombination von zur Schau gestelltem Machertum und dem Versprechen einer leuchtenden technologischen Zukunft lässt seine Anhängerschaft offenbar stetig wachsen: „Mit Tesla will er den Klimawandel stoppen, mit Twitter die Meinungsfreiheit retten, seine Lieblings-Kryptowährung Dogecoin soll nicht die Finanzelite reich machen, sondern ‚the people‘s crypto‘ sein“. Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonao bezeichnete ihn nicht weniger euphorisch als „Mythos der Freiheit“. Dies nicht gerade zufällig: Seit Monaten wird berichtet, dass Musk politisch nach rechts driftet, sich für Verschwörungserzählungen anfällig zeigt, für die Republikanische Partei und für den Ex-Präsidenten Trump wirbt. Ob die Übernahme und somit absolute Kontrolle über den Kurznachrichtendienst Twitter, einer wichtigen globalen Informationsplattform, sein Image auch bei vielen seiner bisherigen Fans beschädigen wird, bleibt vorerst abzuwarten.
„Die Erziehung eines Libertären“
Ähnlich einflussreich wie die Kultfigur Musk, aber weitaus weniger im öffentlichen Rampenlicht stehend, ist der aus Frankfurt am Main stammende US-Milliardär Peter Thiel. Auch der Gründer des Online-Bezahldienstleisters PayPal und erste Großinvestor bei Facebook setzt auf die Republikaner: Im Jahr 2016 verhalf er mit gigantischen Summen Donald Trump zur Präsidentschaft. Seine provokanten politischen Überzeugungen legte der libertäre Vordenker der politischen Rechten in den USA in zahlreichen Vorträgen, Essays und Buchpublikationen dar. So zum Beispiel im Frühjahr 2009 in dem vielbeachteten Essay „The Education of a Libertarian“, den er auf Einladung der ultrakonservativen Denkfabrik Cato Institute vorlegte. Persönliche Freiheit sei das höchste Gut überhaupt, heißt es dort zu Beginn. Er stemme sich gegen Steuererhebungen, die „beschlagnahmenden“ Charakter hätten, lehne totalitäre Systeme ebenso ab wie die Ideologie von der Unausweichlichkeit des Todes jeden Einzelnen: „For all these reasons, I still call myself ‚libertarian‘“.
Auch glaube er nicht mehr daran, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar seien. Das seit 1920 zu beobachtende gewaltige Anwachsen des Wohlfahrtsstaates und die Ausweitung des Frauenwahlrechts seien verantwortlich dafür, dass die Idee einer „capitalist democracy“ ein Widerspruch in sich sei. Soll heißen: Selbst eine moderate staatliche Politik des sozialen Ausgleichs und der demokratischen Mitsprache passe nicht zum Konzept der Freiheit, die mit dem Kapitalismus identisch ist. Dieser von ihm geäußerte Gedanke führe seiner Meinung nach zur eigentlichen Aufgabe der Libertären, einen Ausstieg aus der Politik in all ihren Formen zu finden. Er lege seinen Fokus auf die Entwicklung neuer Technologien, die einen „neuen Raum für Freiheit“ schaffen könnten. Noch unentdeckte Gebiete müssten erschlossen werden, um neue Formen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens auszuprobieren. Als „technological frontiers“ nennt Thiel den Cyberspace, den Weltraum und die Besiedelung der Weltmeere.
Wie Thiel weiter meint, habe er als Unternehmer und Investor seine Anstrengungen auf das Internet konzentriert. So wolle er eine von jeder Regierungskontrolle freie Weltwährung schaffen, um die Währungssouveränität der Staaten zu beenden. Konzerne wie Facebook hätten in den 2000er Jahren den Raum für einen neuen Umgang mit konfligierenden Interessen oder abweichenden Meinungen („new modes of dissent“) und neue Wege zur Errichtung von nicht an Nationalstaaten gebundene Gemeinschaften geschaffen. Der Weltraum bietet nach Thiel „eine grenzenlose Möglichkeit zur Flucht vor der Weltpolitik“. Die Raketentechnologie habe aber seit den 1960er Jahren nur wenige Fortschritte gemacht. Notwendig sei eine „Verdoppelung der Anstrengungen für die kommerzielle Raumfahrt“. Eine „libertäre Zukunft“ im All, wie sie bekannte Science-Fiction-Autoren beschrieben hätten, könne in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts möglich werden. Zwischen Cyberspace und Weltall verortet Thiel als Ideologe uneingeschränkter technologischer Machbarkeit die Besiedelung der Ozeane. Diese solle einen dauerhaften Lebensraum ohne jeden Einfluss von Staaten schaffen.
Weltraum und Militär
Thiels Karriere ist eng mit diversen US-Techriesen und mit dem militärisch-industriellen Komplex verknüpft. Sein finanzielles Engagement bei Facebook führte zu einer jahrelangen Freundschaft mit dessen CEO Marc Zuckerberg. Der Bezahldienst Paypal entstand aus einem Zusammenschluss von Firmen Thiels und Elon Musks im Jahr 2000. Die 2004 gegründete Datenanalyse- und Softwarefirma Palantir brachte Thiel schließlich 2020 an die Börse. „Palantir (‚sehender Stein‘)“, schreibt Werner Rügemer, „ist einer der wichtigsten Softwarezulieferer für die US-Geheimdienste FBI, CIA und NSA, aber auch für das Department of Home Security, für (…) Air Force, Marines und die US-Katastrophenschutzbehörde.“ (Rügemer, Seite 145) Trotz seiner behaupteten staatskritischen Attitüde als Libertärer entwickelte Thiel das Unternehmen Palantir mit seinen weltweit knapp 3.000 Mitarbeiter*innen zu einem engen Partner von Regierungen, Behörden, dem Militär und der Großindustrie.
In das von seinem ehemaligen Paypal-Kollegen Elon Musk im Jahr 2002 gegründete Weltraumunternehmen SpaceX investierte Thiel die ersten 20 Millionen Dollar (vgl. Wagner, Seite 95). Selbstredend gilt Thiel als großer Fan von Musks Projekt, den Mars zu besiedeln – er ist an dessen Finanzierung beteiligt (vgl. n-tv). Im Oktober 2022 wurde bekannt, dass er nun auch in ein oberbayerisches Start-up investiert, das unbemannte Flugobjekte an die Ukraine liefert. Zusammen mit dem Berliner Risikokapitalgeber Project A steigt Thiel mit 17,5 Millionen Dollar bei der Drohnenfirma Quantum Systems ein. Bisher ist es bei deutschen Startups eher verpönt, offen im Rüstungssektor tätig zu werden – Investoren aus der Venture Capital-Branche schließen Investments in Rüstungsprojekten in der Regel aus. Quantum aber lieferte im Frühjahr die ersten Überwachungsdrohnen zur Ausspähung russischer Truppen an die Ukraine. Weitere sollen folgen. Da die Grenzen zwischen Aufklärungs- und Waffensystemen in Zeiten der vernetzten Kriegsführung immer mehr verschwimmen, fallen offensichtlich – mit kräftiger Unterstützung des Neuinvestors Peter Thiel – bei deutschen Startups zunehmend bisher vorhandene Hemmungen, sich militärisch zu engagieren (vgl. Handelsblatt vom 21. Oktober 2022 und Süddeutsche Zeitung vom 18. Oktober 2022).
Weltmeer und Seestädte
Wie stellt sich Thiel aber nun eine Gesellschaft der Zukunft vor, in der Freiheit im Sinne des Libertarismus handlungsleitend sein soll? In jedem Fall in Form „freier Räume“ jenseits staatlicher Regulation. Zum Beispiel auf hoher See, denn das Meer und ferne unbewohnte Inseln gehören scheinbar niemanden, sind also eine Welt, die nach Thiel und Co. nur darauf wartet, angeeignet zu werden.
„In der Geschichte des Kolonialismus“, heißt es in einem FAZ-Artikel von Theresia Enzensberger, „war das unbeschriebene Blatt schon immer eine nützliche Illusion. Das Niemandsland war für die kolonisierenden Seefahrer eine ganz selbstverständliche Erweiterung ihres geschichtslosen, unbeanspruchten Meeresraums.“ Deren Erben im heutigen Silicon Valley sähen sich als Pioniere, als Entdecker von neuen Möglichkeiten und Lebenswelten. „Wenn Elon Musk die indonesische Insel Biak gegen den Widerstand der indigenen Bevölkerung durch eine Startrampe in ein ‚Space Island‘ verwandeln will; wenn Peter Thiel in das Seasteading Institute investiert, das vorhat, künstliche Inseln zu errichten; wenn der Rohstoffhändler Titus Gebel in Honduras freie Privatstädte entwickelt, bei denen die Regierung durch einen ‚Staatsdienstleister‘ ersetzt wird, dann tun sie das alle im Namen der Aufklärung – wie schon die Seefahrer Jahrhunderte vor ihnen.“
Das genannte Seasteading Institute wurde 2008 von Patri Friedman gegründet – dem Enkel Milton Friedmans, des Begründers der Chicagoer Schule, und Sohn des Anarcho-Kapitalisten David Friedman. Sein Projekt, eine „radikal libertäre“ Seestadt zu entwickeln, wurde von Thiel durch eine Spende von einer halben Millionen Dollar ins Rollen gebracht (vgl. Kemper, Seite 62f.). Laut Wikipedia-Eintrag bezeichnet „Seasteading“ (engl. Sea [Meer] und homesteading [Besiedlung, Inbesitznahme]) das Konzept, Stätten dauerhaften Wohn- und Lebensraums auf dem Meer zu schaffen, außerhalb der von nationalen Regierungen beanpruchten Gebiete. Die Washington Post beschrieb im Jahr 2011 Thiels Ideen näher:
„Thiel believes these islands may be important in ‚experimenting with new ideas for government‘, such as no welfare, no minimum wage, fewer weapons restrictions, and looser building codes.“ („Thiel glaubt, dass diese Inseln wichtig sein könnten, um mit ‚neuen Ideen für Regierungen zu experimentieren‘, wie z.B. keine Sozialhilfe, kein Mindestlohn, weniger Waffenbeschränkungen und lockerere Bauvorschriften.“ Vgl. Hinweis und Übersetzung im „ZDF-Magazin Royale“ vom 11. Februar 2022)
Am Ende seines Essays „The Education of a Libertarian“ (2009) wünscht Thiel übrigens Patri Friedman für sein außergewöhnliches Experiment nur das Beste.
Kryptowährung
Thiel ist auch ein langjähriger Fan von Digitalwährungen wie etwa Bitcoin. Er wird nicht müde, gegen alle Barrieren anzukämpfen, die seinem Ziel im Wege stehen, eine von staatlichen Banken unabhängige Währung zu schaffen. Mit seiner Firma PayPal wollte er damit nichts weniger als das Weltfinanzsystem aus den Angeln heben. Zunächst profitierte er aber persönlich davon. Über seinen Founders Fund investierte er 2017 rund 20 Millionen Dollar in die Kryptowährung; schon Anfang 2018 soll sein Investment laut Manager Magazin hunderte Millionen Dollar wert gewesen sein.
Auf der Konferenz „Bitcoin 2022“ im April 2022 in Miami Beach griff Thiel dann die drei bekannten Größen der US-Finanzindustrie frontal an: Warren Buffett, den JP Morgan-Chef Jamie Dimon und Blackrock-Chef Larry Fink. Er machte sie für die aktuelle Kursschwäche der Kryptowährung verantwortlich und beschimpfte sie als „Finanz-Gerontokraten“, die sich gegen die „revolutionäre Jugendbewegung“ rund um die Digitalwährung Bitcoin verschworen hätten. Er warf ihnen vor, den Trend zu nachhaltigen Investitionsansätzen gegen Bitcoin-Anlagen zu stützen (wegen des hohen Stromverbrauchs beim Mining achten Investoren offensichtlich mittlerweile auf mehr Energieeffizienz). Das Handelsblatt kommentierte dies am 8. April 2022 wie folgt:
„Thiels Verbalattacke einfach als unschöne Stimmungsmache abzutun wäre (…) zu einfach. Denn seine Rhetorik ist gefährlich. Thiel spricht von ‚Feindeslisten‘, Buffett nennt er den ‚Feind Nummer eins‘, Nachhaltigkeitsansätze seien eine ‚Hassfabrik‘, die er mit der Kommunistischen Partei Chinas gleichsetzt. Sinngemäß drückt er damit aus: Bitcoin bedeutet Freiheit, alles andere ist Diktatur. (…) Um diesen Standpunkt zu legitimieren, inszeniert sich der 54-Jährige, ironischerweise je nach Betrachtung selbst schon ein alter weißer Mann, als Interessenvertreter einer Jugendbewegung. Doch erstens besteht gerade in der jungen Generation ein starkes Verantwortungsgefühl gegenüber der Umwelt. Während Thiel den Staat am liebsten abschaffen würde, befürworten gerade viele junge Menschen Einschränkungen zugunsten größerer Nachhaltigkeit.“
Thiels Jugendkult passt übrigens zu einzelnen von ihm geförderten Forschungsprojekten, die das Ziel verfolgen, den biologischen Alterungsprozess aufzuhalten. Beispielsweise steckt er Geld in die Kryonik, einer Technologie, die es ermöglichen soll, Menschen nach ihrem Ableben einzufrieren, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzutauen. Thiel erklärte bereits 2012, der Tod sei ein Problem, das sich lösen ließe. Laut Medienberichten wollte er an umstrittenen klinischen Tests teilnehmen, bei denen sich Erwachsene das Blut jüngerer Menschen spritzen lassen, um selbst wieder jugendlich frisch zu werden – in den USA als „Vampir-Therapie“ bekannt. Ende Oktober 2022 boten Internetportale dazu eine passende Meldung: Elon Musk hatte eine Reihe von Prominenten aus der globalen Tech-Szene und einzelne Hollywood-Stars zu einer Halloween-Party auf ein rumänisches „Dracula-Schloss“ eingeladen. Auch Peter Thiel stand auf der Gästeliste. Ein Sinn für skurrilen Humor ist den Tech-Milliardären kaum abzusprechen.
Königsmacher der neuen Rechten
Thiel hat allerdings bei öffentlichen Auftritten bestritten, ein Vampir zu sein. Das Manager Magazin hält in seiner Oktoberausgabe 2022 eine weitere Metapher für ihn bereit. Nach Auffassung des Blatts schürt Thiel schon lange Umsturzfantasien und greift als „Dark Lord“ nicht weniger als nach der politischen und gesellschaftlichen Macht in den USA. Sein Selbstverständnis zeigt eine mehrtägige Konferenz, zu der seine Capital-Venture-Firma Founders Fund Anfang 2022 in ein luxuriöses Hotel in Miami Beach einlud. Die „wichtigsten Unruhestifter unserer Kultur“ (unter anderem Elon Musk) versammelten sich dort unter dem Motto „A Conference for Thoughtcrime“. Die Teilnehmer*innen verstanden sich offenbar als Ketzer und Nonkonformisten, die „‚von anderen Konferenzen verbannt sind‘, wie es in der Einladung hieß. (…) Die Besucher sollten sich mit Widerspruch und unpopulären Ideen beschäftigen, wesentlich für den Fortschritt der menschlichen Zivilisation.“
Das Manager Magazin ernannte Peter Thiel als „Megaspender“ der Republikanischen Partei zum „Königsmacher der radikalen Rechten“. Denn mit seinen Millionen wolle er den Machtwechsel im US-Senat herbeiführen – und unterstützte bei den US-Zwischenwahlen im November zwei Trump-Anhänger und politische Newcomer, die selbst aus der Venture-Capitalist-Branche kommen: J.D. Vance (Ohio) und Blake Masters (Arizona). „Sie überbieten sich mit kruden Thesen von rassistischen Anspielungen, Verschwörungstheorien und Attacken auf die ‚woke culture‘, die Bewegung gegen Diskriminierung.“ Thiel selbst ist seit 2016 Großspender der Republikaner und gilt seitdem als Vertrauter und Berater von Ex-Präsident Trump. Dies ist ungewöhnlich, weil es auch in den USA offenbar eher selten ist, dass sich das „Wagniskapital“ direkt parteipolitisch einmischt. Anders bei Thiel: „‚Die Politik hat immer mehr Raum bei ihm eingenommen. Peter ist superpolitisch, und das schon seit fünf, sechs Jahren‘“. So zitierte das Handelsblatt jedenfalls am 8. Februar 2022 eine ihm nahestehende Person. Thiel, im gesellschaftspolitisch eher liberal geprägt Silicon Valley als Außenseiter geltend, versucht die Republikaner politisch weiter nach rechts zu verschieben, in dem er systematisch als Netzwerker agiert. Der amerikanische Universitätsprofessor Moira Weigel erklärte Mitte des Jahres gegenüber dem britischen Guardian, dass Thiel selbst aber gar nicht entscheidend sei: „What matters about him is whom he connects.“ Thiel stelle die Kontakte und Verbindungen her zwischen den „most rightwing politicians in recent US-history“.
Thiel möchte aber offensichtlich auch seine Kontakte nach Europa intensivieren. So heuerte Österreichs Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz Anfang 2022 bei der Investmentfirma Thiel Capital als „Global Strategist“ an. Vor allem die guten Kontakte des ehemaligen ÖVP-Politikers zu Autokraten im osteuropäischen Raum und zur EU könnten Thiel bei der Entwicklung seines rechten Netzwerks von Nutzen sein. Kurz war zuvor wegen Korruptionsvorwürfen als Kanzler zurückgetreten und hatte alle politischen Ämter niedergelegt.
Herrschaft der Monopole
Der vorgeblich staats- und politikferne Tech-Milliardär scheut also nicht vor einer engen Kooperation mit einflussreichen und die freie Marktwirtschaft verherrlichenden (Ex-)Politikern zurück. Die suchen umgekehrt seine Nähe – ungeachtet der von Thiel provokant vertretenen Auffassung, Kapitalismus und Wettbewerb seien für ihn unvereinbar. „Für weite Teile der Allgemeinheit“, schreibt sein Biograf Thomas Rappold, „gilt der Grundsatz, dass Kapitalismus und Wettbewerb Synonyme sind. Tatsächlich sind sie für Thiel aber Gegensätze.“ (Rappold, Seite 37) Aufsehen erregte Thiel immer dann, wenn er öffentlich feststellte, dass er das Prinzip des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs für innovations- und profithemmend halte und deshalb die Herrschaft kapitalistischer Monopolunternehmen befürworte. Gründer sollten einen Monopolstatus anstreben, das heißt eine einzigartige Firma aufbauen und sich stark von Wettbewerbern differenzieren, um nicht in eine Wettbewerbssituation zu geraten. Marktführer der Digitalwirtschaft, wie Apple, Microsoft, Facebook und Amazon, seien als Garanten des technologischen Fortschritts ein Segen für die Entwicklung der Menschheit (vgl. auch Wagner, Seite 68). Zwischen Politik und Technologie bestehe deshalb ein Wettkampf auf Leben und Tod – so schrieb er es in seinem im Jahre 2009 erschienenen Essay.
Steuerparadies
Recht erfolgreich kämpft Thiel gegen den Staat aber auch in eigener Sache. Steuern sind die wichtigste Einnahmequelle für Staatsapparate. Auf große Teile seines Vermögens, das der Bloomberg Billionaires Index am 10. November 2022 auf 7,14 Milliarden US-Dollar taxiert, zahlt Thiel aber seit mehr als zwei Jahrzehnten keine Steuern. Eine Grauzone des US-Steuerrechts ermöglicht es ihm, in einem Rentenfonds Milliarden Dollar steuerfrei zur Seite zu schaffen. „Thiel verteidigt seine persönliche Steueroase inmitten der USA mit allem, was er hat. Dass sie unangetastet bleibt, ist unter republikanischer Regierung deutlich wahrscheinlicher.“ (Manager Magazin, Seite 116) Offenbar wird der großzügige Sponsor der amerikanischen Rechten von privaten Verlustängsten geplagt.
Ängstlicher Visionär
Seine technokratischen Allmachtsfantasien und erfolgreichen Investitionsentscheidungen sowie sein politisches „Networking“ haben den selbsternannten „Contrarian“ (Querdenker, Nonkonformist) für viele zu einer ähnlichen Lichtgestalt wie Elon Musk gemacht. So schreibt der Thiel-Biograf Rappold, selbst Internetunternehmer und Investor: „Die Gabe, Dinge in hellseherische Voraussicht zu sehen und dann unmittelbar und konsequent in konkrete Handlungen umszusetzen, ist nur wenigen gegeben. Thiel ist ohne Zweifel ein großer Denker mit einer starken Vision auf die Sicht der Welt.“ (Rappold, Seite 107)
Aber der Visionär trifft auch auf Gegner. Zum Beispiel in Neuseeland, das sich Thiel als Rückzugsort für apokalyptische Zeiten sozialen, politischen oder ökologischen Zerfalls ausgesucht hat (vgl. The Guardian vom 18. August 2022). Im Jahr 2011 sicherte sich der US-Amerikaner, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, einen neuseeländischen Pass, obwohl er sich gerade erst zwölf Tage im Land aufgehalten hatte. Um eine Staatsbürgerschaft zu erhalten, müssen Bewerber*innen üblicherweise mindestens 1.350 Tage in fünf Jahren in dem Staat gelebt haben. Aber für den erfolgreichen Unternehmer drückten die neuseeländischen Behörden offenbar beide Augen zu. Die wohlwollende Entscheidung wurde 2017 bekannt – erwies sich dann aber in der Öffentlichkeit als höchst umstritten.
„Thiel“, schreibt Rappold, „reiht sich damit ein in ein Silicon-Valley-Phänomen: Obschon die Vordenker für eine neue Welt gerne viel Optimismus in der Öffentlichkeit versprühen, wenn sie ihre Innovationen als gesellschaftliche Durchbrüche messiasartig ihrer weltweit treu ergebenen Fangemeinde präsentieren, sorgen sich immer mehr wohlhabende Silicon-Valley-Größen um ihre eigene Zukunft. Während Thiel sich einen Zufluchtsort im malerischen Neuseeland ausgesucht hat, kaufen sich andere in luxuriöse Bunkeranlagen ein, horten Treibstoff und Nahrungsmittel. (…) Vielen gemein ist eine geradezu dystopische Sicht auf die Welt. Wer viel hat, kann eben auch viel verlieren.“ (Rappold, Seite 293)
Quellen
Bücher:
Andreas Kemper: Privatstädte. Labore für einen neuen Manchesterkapitalismus, Münster, 2022
Thomas Rappold: Peter Thiel. Facebook, PayPal, Palantir. Wie Peter Thiel die Welt revolutioniert, München, 2017
Werner Rügemer: Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts, Köln, 2018
Thomas Wagner: Robokratie. Google, das Silicon Valley und der Mensch als Auslaufmodell, Köln, 2015
Artikel:
Heike Buchter et al.: „Elon Musk sein“, Die Zeit vom 25. Mai 2022
Diana Dittmer: „Der Mann, der Trump wieder an die Macht bringen will“, n-tv, 12. Mai 2022
https://www.n-tv.de/wirtschaft/US-Milliardaer-Peter-Thiel-Der-Mann-der-Trumps-Truppen-in-Stellung-bringt-article23116635.html
Theresia Enzenberger: „Die Möglichkeiten einer Insel“, FAZ (Online) vom 19. September 2022
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/privatstaaten-von-techmilliardaeren-die-moeglichkeiten-einer-insel-18385728.html
Elizabeth Flock: „Peter Thiel, founder of Paypal, invests $1.24 million to create floating micro-countries“, The Washington Post vom 17. August 2011
https://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/peter-thiel-founder-of-paypal-invests-124-million-to-create-floating-micro-countries/2011/08/17/gIQA88AhLJ_blog.html
Thomas Fromm: „Peter Thiel investiert in Quantum Systems aus Gilching “, Süddeutsche Zeitung (Online) vom 18. Oktober 2022
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/peter-thiel-drohnen-ukraine-quantum-systems-1.5676733
Edward Helmore, „‚Don’ of a new era: the rise of Peter Thiel as a US rightwing power player“, The Guardian vom 30. Mai 2022
https://www.theguardian.com/technology/2022/may/30/peter-thiel-republican-midterms-trump-paypal-mafia
Felix Holtermann et al.: Peter Thiel im Wahlkampf: Die Wagniskapitalgeber greifen an“, Handelbslatt (Online) vom 8. Februar 2022
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/us-zwischenwahlen-peter-thiel-im-wahlkampf-die-wagniskapitalgeber-greifen-an/28049440.html
Larissa Holzki: „Quantum Systems aus München erhält Thiel-Invest“, Handelsblatt (Online) vom 21. Oktober 2022
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/drohnen-hersteller-quantum-systems-aus-muenchen-erhaelt-thiel-invest/28748324.html
Christina Kyriasoglou: „Dark Lord“, Manager Magazin, Oktober 2022, Seite 110-116
Tess McClure: „Billionaire Peter Thiel refused consent for sprawling lodge in New Zealand“, The Guardian vom 18. August 2022
https://www.theguardian.com/technology/2022/aug/18/peter-thiel-refused-consent-for-sprawling-lodge-in-new-zealand-local-council
Mareike Müller: „Peter Thiel erzählt Unsinn über den Bitcoin – und rückt immer weiter nach rechts“, Handelsblatt (Online) vom 8. April 2022
https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/kommentar-peter-thiel-erzaehlt-unsinn-ueber-den-bitcoin-und-rueckt-immer-weiter-nach-rechts/28239920.html
Peter Thiel: „The Education of a Libertarian“, Cato Unbound: A Journal of Debate, 13. April 2009
https://www.cato-unbound.org/2009/04/13/peter-thiel/education-libertarian/